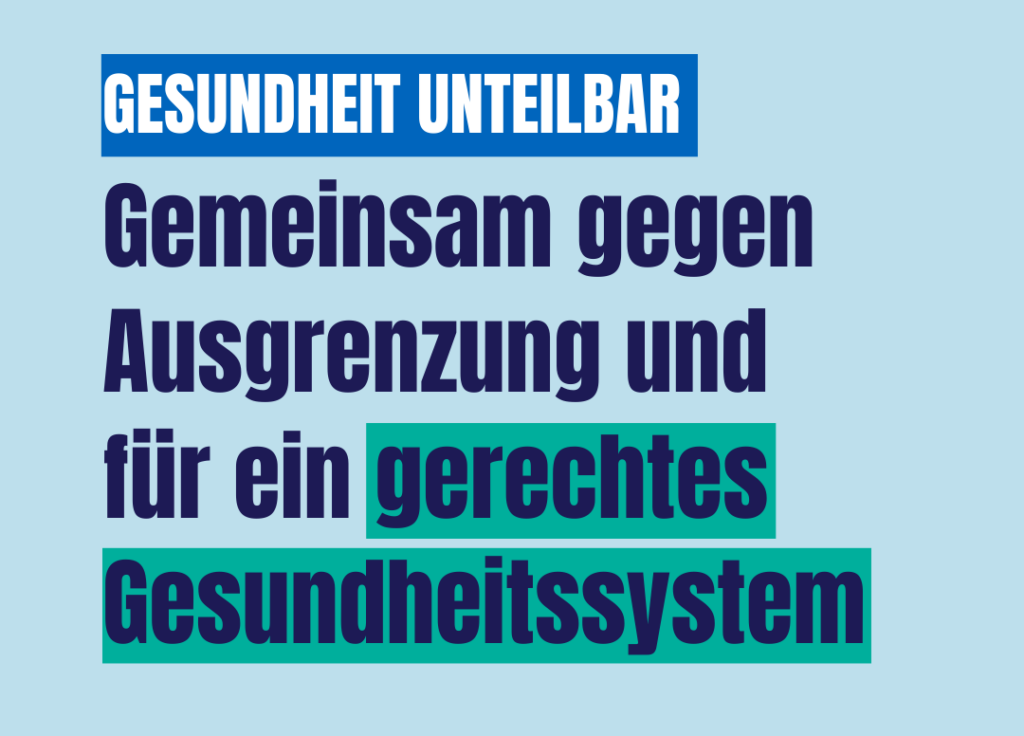Bereits Monate vorher hatte man sich in den Standeszentralen nämlich ernsthafte Gedanken über die neue Gruppierung gemacht. Das Deutsche Ärzteblatt stellte am 4. April 1986 fest, dass sich die „Umstürzler organisieren“ wollten, nachdem diese „ohne großes Aufsehen zu erregen, in diesen Jahren den Marsch durch die Institution (Ärztekammerversammlungen) angetreten“ hätten. Anlass dieser Einschätzung war ein seit Monaten kursierendes Diskussionspapier der Vorbereitungsgruppe. Dieser auf der Grundlage der verschiedenen Listen-Wahlaufrufe und des Positionspapiers der „Arbeitsgemeinschaft der Listen demokratischer Ärzte“ erstellte Programmentwurf wurde auf dem Gründungskongress zwei Tage lang diskutiert, ergänzt, konkretisiert, aktualisiert. Die endgültige, in Frankfurt am Main beschlossene Fassung wurde nach Überarbeitung durch einen Redaktionsausschuss im März 1987 als Broschüre zusammen mit der Vereinssatzung der Öffentlichkeit vorgelegt. Der auf dem Gründungskongress für zunächst ein Jahr gewählte Vorstand spiegelt die relative starke Beteiligung von Ärztinnen wieder. In den geschäftsführenden Vorstand wurden als Vorsitzender Winfried Beck aus Offenbach, Beate Schücking aus Marburg und Birgit Drexler-Gormann aus Mühlheim als Stellvertreterinnen gewählt. Aber auch die Verwurzelung des Vorstandes in den Ärztekammerlisten aller Bundesländer findet ihren Ausdruck in der Zusammensetzung des 21-köpfigen erweiterten Vorstandes, dem Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen und West-Berlin angehören (Norbert Weyres, Brühl; David Klemperer, Düsseldorf; Hannelore Hauß-Alberts, Duisburg; Gregor Weinrich, Bonn; Hermann Gloning, München; Jochen George, Mannheim; Stephan Straub, Stuttgart; Gine Elsner, Bremen; Alf Trojan, Hamburg; Ina Dickmann, Hannover; Udo Schagen, Berlin; Erni Balluff, Frankfurt; Enrique Blanco-Cruz, Frankfurt; Jürgen Seeger, Frankfurt; Hans-Ulrich Deppe, Frankfurt; Hans Mausbach, Frankfurt; Ernst Girth, Frankfurt; Sigmund Drexler, Mühlheim/Main; Krishen Gross, Frankfurt; Brigitte Ende-Scharf, Wiesbaden; Cornelia Krause-Girth, Frankfurt). Zur inhaltlichen Vertiefung der programmatischen Aussagen wurden Arbeitsgemeinschaften zu den Themen Frauen, Gentechnologie, Arzthelferinnen, Ausbildung, Weiter- und Fortbildung, ambulante Versorgung, Psychiatrie und Dritte Welt gebildet.
Die Vorgeschichte
Die Vorgeschichte des Vereins reicht mindestens zehn Jahre zurück. 1976 hatte sich erstmals eine Gruppe in der ÖTV organisierter hessischer Ärztinnen und Ärzte entschlossen, mit einem Aufruf zu den damals stattfindenden Kammerwahlen zu kandidieren. Als zahlende Zwangsmitglieder der Landesärztekammer Hessen wollten sie nicht länger tatenlos zusehen, wie mit ihren Geldern und in ihrem Namen nicht nur für die Ärzteschaft wesentliche politische Meinungen und Entscheidungen in der Kammer entwickelt und von dort aus verbreitet wurden. Sie wollten konkret und unmittelbar Einfluss nehmen, hatten doch die außerparlamentarischen Aktionen wie die der „Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Ärzte“ (AuA) allzu wenig Wirkung auf die Standespolitik gezeigt. Das Ergebnis der Wahl zur Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen mit 10,5 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Liste 6, Liste demokratischer Ärzte, war für alle überraschend. Es sollte keineswegs, wie die Etablierten zunächst prophezeiten, eine Eintagsfliege sein, kein die Eintracht der Standesverbände nur vorübergehend störendes Ereignis bleiben.
Die standeskritischen Aussagen, die Ablehnung einer kommerzialisierten Medizin in tiefer Abhängigkeit von der Pharmaindustrie, die Forderung nach sozialer Dimension des ärztlichen Berufes fanden Eingang in Listenaufrufe zu Kammerwahlen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Hamburg, Bayern, West-Berlin, Bremen und Niedersachsen und brachten den Listen überall einen Stimmenanteil von mindestens zehn Prozent mit steigender Tendenz bei weiteren Kandidaturen.
Besonders eindrucksvoll zeigte sich diese Entwicklung zum Zeitpunkt der Gründung des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Die Listen demokratischer Ärzte erreichten bei den Kammerwahlen in Baden-Württemberg durchschnittlich 22 Prozent, die Hamburger Ärzteoppositionen und Ärzte in München und Nürnberg 27 Prozent, und die Fraktion Gesundheit in West-Berlin errang gar 49 Prozent der abgegebenen Stimmen.
Diese Verbreiterung der oppositionellen Ärztekammerbewegungen machte eine überregionale Zusammenarbeit notwendig. Anträge in den Delegiertenversammlungen, die Einschätzung der traditionellen Verbände und Listen, besonders der Umgang mit dem Marburger Bund und dessen jegliche Kooperation vermissen lassendes Verhalten, die zahlreichen formalen Fragen der Kammertätigkeit, wie Beitragsordnungen, Wahlordnungen, Satzungsfragen usw., erforderten immer häufiger Kontakte der Listen untereinander. Es kam in der Konsequenz dieser Entwicklung im Dezember 1982 in Dortmund zur Gründung einer überregionalen Arbeitsgemeinschaft, der „Arbeitsgemeinschaft der Listen demokratischer Ärzte“. Die gemeinsamen Vorstellungen und Ziele wurden in einem Positionspapier „Gemeinsam gegen den Sozialabbau zur Wehr setzen“ (Frankfurter Rundschau vom 12. Juli 1983) festgehalten. Der Arbeitsgemeinschaft schlossen sich die Liste demokratischer Ärzte Hessen, Nordwürttemberg, Saarland, Westfalen-Lippe, die Liste soziales Gesundheitswesen Nordrhein sowie die Unabhängige Liste demokratischer Ärzte Nordbaden und Rheinland-Pfalz an. Eine lose Zusammenarbeit sagten die Hamburger Ärzteopposition und die Berliner Fraktion Gesundheit zu.
Ähnlich wie bei der Namensfindung des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte hatte es schon hier Diskussionen zu der Formulierung „demokratisch“ gegeben. Mangels einer anderen, den politischen Anspruch ausreichend korrekt und eindeutig wiedergebenden Bezeichnung einigte sich die überwiegende Mehrzahl der anwesenden Listenvertreter auf diese durch die Listenmehrheit bereits geprägte Namensgebung, die schließlich auch Pate für den Vereinsnamen stand. Hinter dieser Entscheidung steht die Auffassung, dass mit dem Begriff demokratisch am deutlichsten der Anspruch auf Demokratisierung der Kammern, auf Einbindung der Interessen der Bevölkerung und Abgrenzung von den Standesverbänden getroffen wird.
Fortan organisierte die Arbeitsgemeinschaft mit Geschäftsführung und Büro in Frankfurt am Main zweimal jährlich Fortbildungsveranstaltungen. Dabei wurden und werden jeweils nach ausführlicher Berichterstattung aus den einzelnen Kammerbezirken Referate zu gesundheitspolitischen Themen gehalten, anschließend diskutiert und regelmäßig eine Stellungnahme bzw. Presseerklärung verabschiedet. Dazu zählen Stellungnahmen zur Einzelleistungsvergütung in der ambulanten Versorgung, zur kassenärztlichen Bedarfsplanung, zur Einführung des Arztes im Praktikum oder zur Gebietsarztweiterbildung ebenso wie auch Presseerklärungen zu aktuellen gesundheitsrelevanten Themen wie Smog und Gesundheit, die Folgen von Tschernobyl und die darauf folgende Reaktion der offiziellen Ärzteschaft. Diese von der Standespolitik abweichenden Positionen trugen wesentlich dazu bei, dass die gewohnte konservativ-reaktionäre Eintönigkeit der Meinungsäußerung aus ärztlichem Munde zunehmend durchbrochen wurde.
Die Öffentlichkeit, hier besonders die neuen sozialen Bewegungen und die DGB-Gewerkschaften, konnte sich fortan auf solidarische und kompetente Unterstützung in grundsätzlichen Fragen durch eine wachsende Minderheit innerhalb der ärztlichen Berufsgruppe stützen, sei es zu Themen wie Arbeitszeitverkürzung mit der Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, nach Abrüstung und Umwidmung von Mitteln zu Gunsten der Erhaltung der Gesundheit, zu Fragen der Umweltzerstörung oder der Frauendiskriminierung.
Warum Gründung eines neuen Ärzteverbandes?
Schon sehr bald zeigten sich die Grenzen des Wirkungsbereiches der Arbeitsgemeinschaft als Zusammenschluss ausschließlich von Delegierten in Landesärztekammern ohne eine organisatorische Basis außerhalb dieser Ärzteparlamente. Zwar konnte das Frankfurter Büro mit Hilfe der regelmäßigen Zahlungen der Delegierten auf ein Sonderkonto einen unregelmäßig viermal pro Jahr erscheinenden Rundbrief mit Veröffentlichungen und Anträgen der Listen erstellen, die Konzentration auf Gremienarbeit ließ die außerparlamentarischen Möglichkeiten jedoch ungenügend genützt. Zunehmend wurde der Wunsch von weniger kammerpolitisch interessierten Kolleginnen und Kollegen nach einem organisatorischen Rahmen für gesundheits- und sozialpolitisches Engagement geäußert. Der wachsende Widerspruch zwischen der Gesundheitsgefährdung durch die ökologische Katastrophe, durch die atomare Bedrohung, durch die sich allgemein verschlechternden Arbeits- und Lebensbedingungen einerseits und die Sprachlosigkeit oder bornierte Hilflosigkeit der Standesführung andererseits hatte bereits alternative ärztliche Bewegungen entstehen lassen. Die Internationale Ärztevereinigung zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) war mittlerweile auch vom Deutschen Ärzteblatt nicht mehr zu übersehen, die Gesundheitstage hatten Signale für einen menschlicheren Medizinbetrieb gesetzt, Ärztinnen und Ärzte beteiligten sich an Selbsthilfe- und anderen Bürgerinitiativen. Eine Alternative zu den mächtigen Standesverbänden, ein Gegengewicht zur Bundesärztekammer mit ihren weit verzweigten Verbindungen zu den konservativen Parteien, dem Innen- und dem Verteidigungsministerium, zur Pharma- und zur Geräteindustrie und zur Versicherungswirtschaft waren und sind diese Bewegungen allerdings nicht.
Wiederholt wurde daher die Anregung zur Gründung eines entsprechenden Verbandes geäußert und genauso oft wieder verworfen. Es waren vor allem zwei Gründe, die gegen eine organisatorische Weiterentwicklung vorgetragen wurden: Zum einen befürchtete man die Bürokratisierung durch eine bundesweite Organisation, die Gefahr der Zentralisierung, die Erstickung basisdemokratischer Strukturen. Zum anderen wurde die Gefahr eines neuen Standesverbandes im alternativen Gewande beschworen, solange ausschließlich Ärztinnen und Ärzte Mitglieder werden konnten. Anzustreben sei vielmehr eine berufsübergreifende Vereinigung aller im Gesundheitswesen Beschäftigten. Dass gerade dieses Ziel in den Friedensinitiativen im Gesundheitswesen nicht erreicht werden konnte, war allerdings noch gut im Gedächtnis, hatte sich doch die IPPNW gegen die zahlreichen berufsübergreifenden Friedensinitiativen durchgesetzt, nicht zuletzt wegen des hohen Sozialprestiges des ärztlichen Berufes. Auch die Erfahrungen im Verein demokratische Zahnmedizin hatten gezeigt, dass aktive Beteiligung anderer Berufsgruppen, hier Zahntechniker und Zahnarzthelfer, de facto nicht stattfindet. Vergleichbares gilt für die Sozialdemokraten im Gesundheitswesen. Die aus der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Ärzte (ASG) hervorgegangene SPD-Arbeitsgemeinschaft hat keine Erhöhung ihrer Wirksamkeit in gesundheitspolitischen Fragen erfahren, im Gegenteil haben die hier organisierten Ärztinnen und Ärzte – vorwiegend Beamte aus der Sozialverwaltung – kaum Einfluss auf die Standesgremien oder andere sozialpolitisch relevante Bereiche. Von ihren tradierten Zielen als Nachfolgeorganisation des Vereins sozialistischer Ärzte der Weimarer Zeit ist nicht einmal der Name übrig geblieben.
Wie bei der ASG hatte die Auflösung des Bundes gewerkschaftlicher Ärzte in der ÖTV (BgÄ) keineswegs zu einer Intensivierung der gemeinsamen Arbeit der im Gesundheitswesen organisierten Berufsgruppen geführt, sondern eher eine Lähmung der wenigen gewerkschaftlich organisierten Ärztinnen und Ärzte bewirkt, sozusagen ein politisches Vakuum hinterlassen. Andererseits: Wie würde sich das Verhältnis eines neuen berufsübergreifenden Verbandes zur ÖTV gestalten? Wäre es nicht sinnvoller, eine solche gemeinsame, alle Berufsgruppen umfassende Arbeit innerhalb dieser Gewerkschaft zu intensivieren, statt einen neuen, möglicherweise mit der ÖTV konkurrierenden Verband zu gründen, also letztlich eine Schwächung der ÖTV in Kauf zu nehmen?
All diese Überlegungen mündeten in die Mehrheitsauffassung, für die Gründung eines „Vereins demokratischer Beschäftigter im Gesundheitswesen“ fehle das entsprechende Fundament.
Andererseits konnten sich die Delegierten auf die jahrelange Erfahrung in den Kammern und auf die bundesweite Struktur der Arbeitsgemeinschaft der Listen stützen. Vor allem aber herrschte die Erkenntnis, dass ein Gegengewicht zu den allmächtigen Kammern und Verbänden dringend geschaffen werden müsse, gab es und gibt es doch keine vergleichbar privilegierte und politisch einflussreiche Berufsgruppe. Die Einführung eines Sanitätskorps in der Bundeswehr und der Entwurf eines Zivilschutzgesetzes waren auf Drängen der Ärzteschaft erfolgt. Die Regelung des § 218 wurde ärztlicherseits entscheidend im Sinne einer Verschärfung beeinflusst. Die kritiklose Unterstützung der Pharmaindustrie, die Verfilzung mit der Versicherungswirtschaft erlebt jeder Berufsangehörige bei den gesponserten Fortbildungsveranstaltungen oder bei Werbeschreiben durch die Kammerpräsidenten für so genannte Gruppenverträge mit privaten Krankenversicherungen, deren Beirat sie angehören. Selbst im internationalen Rahmen zeigt sich der Einfluss der Bundesärztekammer. Die Wiedereingliederung der rassistischen Medical Association of South-Africa (MASA) in den von der Bundesrepublik Deutschland und den USA dominierten Weltärztebund geht vor allem auf die Aktivitäten der bundesdeutschen Delegierten zurück.
War nicht angesichts dieser Machtkonzentration eine reine Ärztevereinigung als Gegengewicht wirkungsvoller als eine viele Berufsgruppen umfassende Organisation? Die hessischen Delegierten der Liste demokratischer Ärzte jedenfalls meinten, nicht länger warten zu können, und entschlossen sich, die Gründung eines bundesweiten Vereins zu initiieren. Sie schafften die formalen Voraussetzungen dafür am 24. September 1985 durch Eintragung in das Frankfurter Vereinsregister und ermöglichten einen inhaltlichen Einstieg durch die Vorlage eines Programmentwurfs. Die weitere Ausgestaltung sollte einer Mitgliederversammlung zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.
Angesichts der Bedeutung für die weitere Diskussion innerhalb der fortschrittlichen Ärzteschaft und der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner sei hier das Programm des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte in seinen Grundaussagen und Forderungen skizziert.
Das Programm
Zentrale Aussage ist das Bekenntnis zum politischen und sozialen Engagement des Arztes. „Die Barrieren zwischen Gesundheit und Politik sind künstlich, sie müssen abgetragen werden, weil sie bei der Bekämpfung von Krankheit und der Förderung von Gesundheit hinderlich sind … Die Einflussnahme auf die Politik mit dem Ziel der Veränderung der Lebens- und Arbeitsbedingungen muss hinzukommen, wenn die Lebensumstände, und damit die Gesundheitslage der Bevölkerung verbessert werden.“
Der Verein sieht sich damit in der Tradition fortschrittlicher Ärztinnen und Ärzte zu Beginn dieses Jahrhunderts. „In der Weimarer Republik repräsentierte u. a. der Verein sozialistischer Ärzte die Tradition der fortschrittlichen Ärztebewegung. Damals wirkten viele politisch unterschiedlich orientierte Ärzte im Sinne der heute von uns vertretenen Ziele, unter ihnen Georg Benjamin, Max Hodann, Julius Moses, Albert Niedermeyer, Wilhelm Reich, mit ihnen auch Alfred Döblin und Friedrich Wolf, die als Schriftsteller bekannt geworden sind. Die faschistische Machtergreifung unterdrückte ihre Ideen und beendete 1933 ihren Einfluss, aber nur für jene zwölf Jahre in Deutschland. Denn ihr Widerstand ging im Exil und in der Illegalität weiter. Ihre Gedanken und Forderungen kehrten nach 1945 zu uns zurück und wirken auch heute noch weiter.“
Im Gegensatz zur bundesdeutschen Standesführung werden die Ziele der Weltgesundheitsorganisation für eine europäische Gesundheitspolitik – das Programm „Gesundheit 2000“ – unterstützt, das Bekenntnis zu den Grundsätzen der Weltgesundheitsorganisation abgelegt: „Wir bekennen uns aus sozialer Verantwortung zu den Grundsätzen der WHO: ,Die Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Die Erlangung des bestmöglichen Gesundheitszustandes ist eines der Grundrechte eines jeden Menschen ohne Unterschied der Rasse, Religion, des politischen Bekenntnisses, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung.’ Wir sehen in dieser Definition eine deutliche Entsprechung zu Artikel 2 (2) unseres Grundgesetzes: ,Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.’“
Breiten Raum nimmt die Beschäftigung mit der Frage der Demokratisierung ein, Demokratisierung nicht nur innerhalb der ärztlichen Berufsvertretungen, innerhalb des Gesundheitswesens, sondern auch im gesellschaftlichen Rahmen. „Die Durchsetzung demokratischer Prinzipien im Gesundheitswesen ist allerdings abhängig von der allgemeinen Entwicklung des demokratischen Fortschritts, denn das Gesundheitswesen lässt sich nicht aus der Gesellschaft herauslösen. Es ist vielmehr eng mit der Wirtschaftsstruktur verbunden. Insofern ist die Demokratisierung stets im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen. Seitdem die tiefgreifende Wirtschaftskrise sich auch nachhaltig im Gesundheitswesen auswirkt, kommt es nicht nur zum Abbau sozialer Leistungen, sondern auch zur massiven Einschränkung und Behinderung der Rechte der Arbeitnehmer. … Für uns steht im Vordergrand ärztlichen Handelns die Orientierung an der sozialen Verantwortung unter demokratischen Arbeitsbedingungen. Wir gehen davon aus, dass dies in einem der reichsten Länder der Erde möglich ist.“
Die konkrete Anwendung dieser grundsätzlichen Positionen wird in den folgenden neunzehn Kapiteln dargelegt. Angesichts der am stärksten das Leben aller Menschen bedrohenden Gefahren eines Atomkrieges steht der Abschnitt „Ärzte gegen den Atomkrieg“ zuvorderst. Gemeinsam mit den Internationalen Ärzten zur Verhütung eines Atomkriegs (IPPNW) wird ein sofortiger Atomteststop gefordert „als erster Schritt zum Abbau radioaktiver Gefährdung und zur Bremsung des Rüstungswettlaufs“. Gegenüber der zivilen Nutzung der Atomenergie bzw. der medizinischen Verwendung ionisierender Strahlung wird eine sehr kritische Position bezogen: „Die Risiken der zivilen Nutzung der Atomenergie sind zu hoch.“ Konsequenterweise wird der sofortige Ausstieg aus der Atomenergie und im medizinischen Bereich die Einschränkung radiologischer Diagnostik bzw. bei deren Anwendung die Unabhängigkeit von kommerziellen Interessen verlangt.
Die gleiche vorsichtige Haltung gegenüber den vielfältigen Einflüssen moderner Technologie auf das Leben der Menschen, der Wechselwirkung zwischen Umwelt und Gesundheit, erfordere eine stärkere Hinwendung zu einer primär-präventiven Krankheitsbekämpfung. Dies schließe die Forderung nach Einrichtung von Instituten für Umweltmedizin, die Schaffung von Planstellen für Umweltingenieure und weitere ökologische Spezialisten in den Gesundheitsämtern ein. „Wir fordern die Verankerung des ,Arztes für Umweltmedizin’ in der ärztlichen Weiterbildungsordnung sowie entsprechende Ausbildung von Medizinstudenten und in anderen umweltschutzorientierten Berufen.“ Ohne einen Ausbau der im internationalen Vergleich unterentwickelten sozial-epidemiologischen Forschung sei allerdings eine Abkehr von der Überbewertung der kurativen Medizin nicht möglich.
Wegen der Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gerade auch in dieser Frage wird diesem Stiefkind unseres Gesundheitswesens ein eigenes Kapitel gewidmet. Bei gleichzeitiger Forderung nach Ausbau und Neustrukturierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird vor der Vereinnahmung für militärische, ordnungsrechtliche und sozialdarwinistische Interessen gewarnt.
Im Abschnitt „Frauen in der Medizin“ wird nicht nur die Diskriminierung der Ärztinnen gegenüber den Ärzten, die Benachteiligung der weiblich Beschäftigten im Gesundheitswesen überhaupt kritisiert, sondern auch auf die Rolle der Frau als Patientin eingegangen. „Typisch weibliche Beschwerden oder Befindlichkeiten werden über die Medizin zu Krankheiten erklärt und profitbringend medizinisch behandelt (z. B. Menstruation, Klimakterium). Ihre psycho-sozialen Zusammenhänge werden vernachlässigt. Statt Selbstständigkeit und Selbstheilungskräfte zu fördern, trägt die Medizin dazu bei, dass Frauen zum ,schwachen Geschlecht’ gemacht werden.“ Und da die Regelung des Schwangerschaftsabbruches die krasseste Form der Frauendiskriminierung darstellt, wird die Fristenlösung als Verbesserung gegenüber der bisherigen Regelung bei Ablehnung jeglicher strafrechtlicher Verfolgung, aber auch die Entwicklung einer kinder-, frauen- und familienfreundlichen Politik gefordert.
Gegenüber der Reproduktionsmedizin wird gerade aus der Sicht der Frauen eine ablehnende Haltung eingenommen: „Wir lehnen diese Form der Sterilitätsbehandlung ab, fordern jedoch mehr Gelder für die ganzheitliche Erforschung der Sterilität und ihre adäquate Behandlung.“
Im Abschnitt „Gentechnologie und Medizin der Zukunft“ wird angesichts einer wachsenden naturwissenschaftlichen Einseitigkeit der Medizin auf die komplizierten Wechselwirkungen, den Gesamtzusammenhang zwischen somatischer und psychosozialer Dimension verwiesen. „Zu fordern ist eine grundsätzliche Umorientierung genetischer Forschung auf die Analyse der Gefahren und die Folgenabschätzung. Weitere Forschungsschwerpunkte sollten auf den Gebieten der Evolutionsbiologie und der Ökologie liegen. Vorläufig sollte keine Erlaubnis der Freisetzung gentechnologisch veränderter Organismen erteilt werden. Die Forschung mit vitalen menschlichen Gameten und lebendem embryonalen Gewebe sind abzulehnen. Auf internationaler Ebene sollte ein Moratorium weiterer gentechnologischer Anwendung bei Kontrolle aller schon existierenden Anwendungsarten durch die Weltgesundheitsorganisation vereinbart werden. Bei schon angelaufenen gentechnischen Arbeiten in Labors sind scharfe Sicherheitskontrollen erforderlich. Bei Feststellung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sind solche Arbeiten abzubrechen. … In vielen Landesärztekammern werden demnächst die Berufsordnungen im Sinne der Beschlüsse des Deutschen Ärztetages 1985 geändert. Die dort verabschiedeten Regelungen schließen einen Missbrauch befruchteter Eizellen nicht aus. Wir setzen uns in den jeweiligen LÄK’s dafür ein, dass dort eindeutige Regelungen Bestandteil der Berufsordnung werden, die Experimente mit befruchteten Eizellen eindeutig verhindern.“
Im Abschnitt „Ausländische Arbeitnehmer, Asylsuchende, Flüchtlinge“ bzw. „Ausländische Ärztinnen und Ärzte“ wird zur Beseitigung der unzureichenden Versorgung dieser Bevölkerungsgruppen die gleichberechtigte und in Ausländerregionen bevorzugte Niederlassungsmöglichkeit für ausländische Ärztinnen und Ärzte gefordert. Dazu gehöre die Abschaffung des § 10 der Bundesärzteordnung und die Schaffung eines Beauftragten für Ausländer im Beirat jeder Landesärztekammer.
In drei Kapiteln wird der Zusammenhang von Krankheit und sozialer Lage analysiert. „Soziale Unterschiede zwischen arm und reich sind bis heute im internationalen Nord-Süd-Gefälle, auch in Europa, die entscheidende Grundlage der Chancenungleichheit auf dem Gebiet von Krankheit und Gesundheit. Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist Chancengleichheit auf dem Gebiete der Gesundheit und im Gesundheitswesen noch keineswegs gewährleistet. So weit sozialepidemiologische Untersuchungen vorliegen, ist sichtbar geworden, dass bei der Verteilung und Häufung von Krankheiten, beim Krankenstand, bei der gesundheitsrelevanten Beschaffenheit von Wohnung und Wohnmilieu, Nahrung, Arbeitsbedingungen und in der Lebenserwartung charakteristische soziale Unterschiede existieren. Das Gleiche gilt für die medizinische Versorgung. Der Teufelskreis von gesellschaftlicher Benachteiligung und vorzeitigem Gesundheitsverschleiß besteht weiter. Weil du arm bist, musst du eher sterben. Daran hat sich auch nach Einführung der Krankenversicherung nichts Entscheidendes geändert. Die ungesündere, belastendere Lebensweise, die man den unteren Gesellschaftsschichten aufzwingt, prägt in entscheidender Weise die Gesundheitslage der Mehrheit der Bevölkerung.“
Im Programm wird scharf kritisiert, dass die herrschende ökonomisierende Gesundheitspolitik unter dem demagogischen Begriff der Kostenexplosion zunehmend Risiken und Kosten auf die Sozialversicherten verlagert. Dies stehe im Widerspruch zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung des Staates für die Gesundheit der Bevölkerung. Gefordert wird eine Begrenzung der Ausgaben der Versicherten und eine Erhöhung der Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung bei Übernahme des verbleibenden Defizits durch Verwendung von Steuergeldern. Die so genannte Selbstbeteiligung sei rückgängig zu machen. „Wir fordern eine Vereinheitlichung der in mehr als 1.000 Krankenkassen zersplitterten Krankenversicherung, die Abschaffung der Privaten Krankenversicherungen und die Aufhebung der Pflichtversicherungshöchstgrenze. Denn nur so können die Krankenkassen zu einer Solidargemeinschaft werden, in der alle gemeinsam die finanziellen Lasten übernehmen – auch und gerade diejenigen mit den höchsten Einnahmen und den geringsten Risiken.“
„Arbeit darf nicht krank machen!“ Unter dieser Überschrift wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Frühinvalidität die krankmachende Wirkung der Arbeitsausübung zeige. Betriebsärzte seien hier besonders gefordert, die Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen aufzuzeigen. Dazu sei deren Unabhängigkeit von der Betriebsleitung erforderlich, werden überbetriebliche Werksarztzentren bei Mitspracherecht der Betriebsräte gefordert.
„Arbeitslosigkeit macht krank.“ Die in dieser Überschrift bereits 1931 belegte Erkenntnis werde von den Standesfunktionären immer noch geleugnet. Im Programm werden daher von der Ärzteschaft ausgehende Impulse und konkret die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich auch als primär-präventive Maßnahme gefordert.
Im Abschnitt „Missstände in der Struktur des Gesundheitswesens“ werden vor allem allgemeine strukturelle Mängel beschrieben. Die Vielzahl ärztlicher Dienste, die scharfe Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, das anachronistische Einzelleistungsvergütungssystem und das ambulante Behandlungsmonopol der Kassenärztlichen Vereinigung werden kritisiert. Darüber hinaus führe die fehlende überregionale Koordination bei fehlender Entscheidungspartizipation der Betroffenen zur bürokratischen Aufblähung der Institutionen und zu der Unfähigkeit, Prävention, Heilbehandlung und Rehabilitation sinnvoll aufeinander abzustimmen.
Als weiteres wesentliches Hindernis auf diesem Wege wird das Vorhandensein eines medizinisch-industriellen Komplexes definiert. Im Kapitel „Bittere Pillen oder das Geschäft mit der Krankheit“ wird eine grundsätzliche Neuorientierung weg von der Medikamenten- und Apparatemedizin gefordert. Anzustreben sei ein Medizinverständnis, das die Ganzheitlichkeit des Menschen begreift und Ansätze zur Verhütung und Lösung psychosozialer Probleme aufzeigt. Die Befreiung der Medizin von kommerziellen Interessen dürfe dabei nicht halt machen vor den Großverdienern unter den Ärzten. Man müsse „den ärztlichen Beruf vom Odium der Gewerblichkeit und der Abhängigkeit von Interessen der pharmazeutischen Industrie befreien und die ärztliche Dienstleistung und Hilfeleistung ihres Warencharakters entkleiden.“
Für die „Medizin in der Dritten Welt“ werden weit über die hiesigen Probleme hinausgehende Schwierigkeiten erkannt. Diese seien angesichts der multinationalen Ausdehnung der Pharmakonzerne einer rein nationalen Betrachtungsweise nicht zugänglich. Die koloniale und neokoloniale Mitverantwortung verpflichte uns zum Eingreifen. Armut als Ursache von achtzig Prozent der Krankheiten in diesen Ländern seien allein durch nationale Programme nicht zu beseitigen. Neben einer Unterstützung aller Bewegungen zur Beendigung der Ausbeutungsverhältnisse wird konkret die Unterstützung des Primary Health Care Konzepts der Weltgesundheitsorganisation und die Unterstützung fortschrittlicher Ärztevereinigungen in Ländern der Dritten Welt gefordert.
Bezüglich der eigenen Geschichte konstatiert das Programm für die Ärzteschaft von 1933 bis 1945 eine unterlassene Aufarbeitung. Noch immer werde die breite Unterstützung und Duldung der Nazis durch die Ärzteschaft geleugnet, würden alle Versuche der Wahrheitsfindung von offizieller Seite diskriminiert, Verbrechen wie die Euthanasie verharmlost. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Bedeutung des Nürnberger Ärzteprozesses für die zeitgemäße Erneuerung medizinischer Ethik allgemein anerkannt wird, und es wird die Zeit kommen, wenn die Namen von ärztlichen Widerstandskämpfern über dem Eingang von Kliniken und Instituten zu lesen sein werden.“
Es ist sicher kein Zufall, dass nach diesem historischen Abschnitt die „Grundzüge einer bedarfsgerechten psychiatrischen Versorgung“ behandelt werden, fand doch während der Diskussion um das Programm der letzte Euthanasieprozess gegen drei Ärzte in Frankfurt am Main statt, bei dem es um die Ermordung Tausender psychiatrisch Kranker ging. Und heute, elf Jahre nach Erscheinen der Psychiatrie-Enquête ist die Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland immer noch in einem reformbedürftigen Zustand, scheitern die insbesondere von der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie entwickelten Vorstellungen an mangelnden finanziellen Mitteln, aber auch an einer immer noch in der Öffentlichkeit vorhandenen Neigung zur Diskriminierung psychisch Kranker. „Die notwendige Reform der entsprechenden Gesetze und die Freigabe der erforderlichen Mittel hat sich an folgenden Leitlinien zu orientieren:
- rechtliche Gleichstellung psychisch Kranker.
- Rechtsanspruch psychisch Kranker auf bestmögliche Behandlung und Betreuung am Wohnort.
- Vorrang ambulanter vor stationärer psychiatrischer Versorgung.“
Wesentliche Mängel in der Qualität ärztlicher Berufsausübung haben ihre Ursache in einer nicht bedarfsgerechten Ausbildung. „Obwohl die ärztliche Approbationsordnung inzwischen zum fünften Mal geändert wird, hat sich die Kritik an der ärztlichen Ausbildung keinesfalls verringert: Nach wie vor fallen theoretische und praktische Ausbildung weit auseinander, und der patientenzentrierte Teil wird vernachlässigt, die Ausbildungszeit hat sich nicht wesentlich verkürzt, die psychosozialen Inhalte führen nach wie vor eine Randexistenz. Ausgebaut und verfeinert wurde indessen das Prüfungssystem, das Inhalte prüft, die zuvor keineswegs entsprechend gelehrt werden.“ Die Ausbildung dürfe nicht als Steuerungsinstrument für eine so genannte Ärzteschwemme benutzt werden, sondern müsse patientenzentriert und auf die Sozialversicherten orientiert werden. Das bedeute für die medizinische Ausbildung:
- „Die Entwicklung interdisziplinären Lernens.
- Die Reduzierung der angebotenen Disziplinen auf Basisfächer, in denen exemplarisch gelehrt wird.
- Die praxisorientierte Ausbildung in kleinen Gruppen.
- Den studienbegleitenden Ausbau der psychosozialen Fächer.
- Dezentrale öffentliche Prüfungen, in denen die Studenten ihr Wissen über medizinische Sachverhalte und Probleme darlegen können.
- Eine Prüfungsform, die sich demokratisch kontrollieren lässt und Prüfungswillkür ausschließt.
- Die Zurücknahme des Arztes im Praktikum.
- Am Ende des Medizinstudiums muss ein berufsqualifizierender Abschluss stehen.“
Für die Auseinandersetzung mit der Standesführung ist die Kritik der organisierten Ärzte-Lobby, der Rolle der Ärztekammern, der Kassenärztlichen Vereinigung und des ärztlichen Verbändewesens besonders wichtig. Die heute wieder völlig unangemessene Machtfülle dieser während der Nazizeit so unrühmlichen Organisationen stehe im Widerspruch zu den vorhandenen Erwartungen der Bevölkerung an die Ärzte und dienten vorrangig der Privilegienwahrung. Dabei werde die Zwangsmitgliedschaft der Ärztinnen und Ärzte als Legitimation für die einseitig reaktionär-konservative Politik missbraucht, würden die Deutschen Ärztetage trotz Ausschaltung eines wesentlichen Teils der Opposition in diesem Sinne funktionalisiert, ohne wirklichen Einfluss auf die Ausschüsse und Gremien mit ihren vielfältigen Verbindungen zur Industrie, zum Militär und zu den politischen Machtzentren. Aber auch die scheinbar so vielfältigen Verbände dienten letztlich dieser Integration der Ärztebasis in die Interessen des medizinisch-industriellen Komplexes, wie am Beispiel des Marburger Bundes und des Hartmannbundes dargelegt wird. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Vertretung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte machten davon keine Ausnahme. Ihrem Wirken sei es zu verdanken, dass die Einkommensschere zwischen sozial engagierten Ärztinnen und Ärzten einerseits und Apparatemedizinern andererseits immer mehr klaffe, dass Abrechnungsbetrug zum Regelverhalten hätte werden können. „Wir brauchen keine solche Standespolitik, die Privilegien und Macht für Wenige anstrebt. Wir brauchen eine Berufspolitik, die Ärztinnen und Ärzte als kompetente Mitstreiter für ein Gesundheitswesen begreift, das optimale Bedingungen für die Gesundheit aller unter gleichen Bedingungen für alle schafft.“
Das Programm schließt mit einem Aufruf: „Wir haben uns deshalb entschlossen, den Verein ,Demokratische Ärztinnen und Ärzte’ zu gründen, und rufen alle, die uns unterstützen wollen, zum Beitritt auf. Wir laden ein, mitzuhelfen, demokratische Perspektiven im Medizin- und Gesundheitswesen durchzusetzen. – Wir wenden uns an die berufserfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die von der bisherigen Standespolitik enttäuscht sind und eine soziale Wende in der ärztlichen Berufspolitik wünschen. Wir sprechen auch die Kolleginnen und Kollegen an, die in den nächsten Jahren die Approbation erhalten werden und denen der Zugang zur beruflichen Existenz erschwert werden soll. Helft uns, dem sinnentleerten, ständisch-fixierten Denken und Handeln seine Grenzen aufzuweisen und das Berufsbild des Arztes im sozialen, humanen und demokratischen Sinne weiterzuentwickeln. – Gleichzeitig rufen wir dazu auf, in allen Bundesländern Listen von Ärztinnen und Ärzten aufzustellen, um bei Kammerwahlen und in den Kammern die drängenden Fragen der Gesundheitssicherung aufzuwerfen und grundlegende Alternativen vorzutragen.“
Die Reaktionen auf die Vereinsgründung und die bisherige Tätigkeit
Die Reaktionen in der Öffentlichkeit auf die Vereinsgründung waren überwiegend positiv. „Frischer Wind von links“ konstatierte das Ärztemagazin Status und stellte bemerkenswerterweise in der gleichen Nummer (5. November 1986) für den Marburger Bund (mb) das „Zerbrechen an seinen inneren Widersprüchen“ fest. Eine mögliche Alternative für das „Heer nichtshabender Ärzte“ formiere sich gegenwärtig in Gestalt des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Auch nicht ärztliche Medien diagnostizierten diese „Konkurrenz von links für die Etablierten gegen die konservativen Medizinerverbände“ (Frankfurter Rundschau, 28. Oktober 1986) kritisiert, bei dem Gründungskongress sei „kein linkes Thema ausgelassen worden“, so muss der Autor doch einräumen, dass der Verein das vorhandene Potenzial „nun in politische Macht“ umsetze. In mehreren Blättern wird die Kritik am herrschenden Abrechnungssystem hervorgehoben. „Die Standespolitiker interessiert doch nur, was abrechenbar ist!“ interpretiert die Ärztliche Praxis (22. November 1986) das Vereinsprogramm, und im SPD-Organ Vorwärts wird die Kritik am „Schummelsystem“ anerkennend hervorgehoben (17. Januar 1987).
Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, Dr. Löwenstein, sah im Vereinsprogramm einen Angriff auf das System. „Der berühmte Marsch durch die Institutionen! Bei den Kammern längst mit großem Erfolg im Gange, hier peilt er nun die KV an.“ In Wahrheit stelle der Verein die „Weichen zu den Ketten der Staatsmedizin und natürlich zu Machtpositionen solcher Vereinspotentaten“. (Referat vom 29.11.1986) Hier gerät die Kritik eines prominenten Standesvertreters gar zur ängstlich-hilflosen Übertreibung der Absichten und auch Möglichkeiten dieses damals nicht einmal vier Wochen alten Vereins. Doch die eigentliche inhaltliche Kritik folgte erst mit zeitlicher Verzögerung. Mittlerweile hatte der Verein durch einen Boykottaufruf gegen die Firmen Sandoz und Ciba Geigy nach der Rheinvergiftungskatastrophe von sich reden gemacht, eine besonders von den nichtärztlichen Medien sehr beachtete Aktion. Die erste Mitgliederversammlung nach dem Gründungskongress hatte „Vorschläge zur Änderung des Honorierungssystems in der ambulanten medizinischen Versorgung“ diskutiert und verabschiedet und damit seine von den traditionellen Ärzteverbänden bezweifelte Kompetenz auch in konkreten berufsspezifischen Fragen unter Beweis gestellt. Für den Kassenarzt wurde daraus ein „Angriff auf die gesamte Ärzteschaft“ (4, 87), denn wenn es um das Geld der Spitzenverdiener geht, dann „hört der Spaß auf“, dann wird eine „Gefahr für alle“ beschworen. Nichts anderes als die pauschalierte Honorierung mit Degression ab einer gewissen Patientenzahl, eine Mindestausstattung der Praxen für die Basisärzte und eine bessere Honorierung primär-ärztlicher Leistungen für die Gebietsärzte bei für dieses weiter geltendem Einzelleistungshonorierungssystem, allerdings unter Aufhebung des kassenärztlichen Behandlungsmonopols wurden gefordert, weil nur so alternative Modelle zur herrschenden ambulanten Versorgung erprobt werden könnten.
Ebenfalls für Unruhe hatte ein im Auftrag des Vereins erstelltes Gutachten des Bremer Professors für öffentliches Recht und wissenschaftliche Politik, Gerhard Stuby, „Zum Recht auf organisierte Opposition in den Ärztekammern und zu den prozessualen Möglichkeiten seiner Durchsetzung“ gesorgt. Denn trotz des Anwachsens der oppositionellen Listen in den Kammern waren die Vertreter aus Hessen, Westfalen-Lippe und drei der vier Bezirke Baden-Württembergs von der Teilnahme am 90. Deutschen Ärztetag in Karlsruhe vom 12. bis 16. Mai 1987 ausgeschlossen. Man fürchtete die zunehmend realer werdende Konkurrenz ebenso wie die mit Unverständnis auf die Ausgrenzung reagierende Öffentlichkeit. Die schärfste Kritik kam allerdings erwartungsgemäß vom Marburger Bund und dem Hartmannbund. Der Vorsitzende des Marburger Bundes, Hoppe, drohte gar mit „Berliner Verhältnissen bald überall“ und der Bewerbung seines Verbandes um Mitgliedschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, wahrlich eine Horrorvision für gestandene Ärztefunktionäre (Ärzte Zeitung vom 30. Januar 1987). Offenbar hatte Hoppe den Vorwurf im Vereinsprogramm noch nicht verdaut, „der einst in seiner Gründungsphase gewerkschaftlich orientierte Marburger Bund trage inzwischen die Zeichen ermüdeter und saturierter Anpassung“.
Ärztliche Vergangenheitsbewältigung
Der Hartmannbund wiederum, im Programm als „deutlich rechts von der CDU stehend“ bezeichnet, „dessen Einfluss neuerdings eher stagniert“, konnte sich mit den Ausführungen zur Rolle der Ärzteschaft von 1933 bis 1945 nicht abfinden. Im Organ des Hartmannbundes, Der deutsche Arzt, vom 25. März 1987 kontert der Leitartikler unter der Überschrift: „Demokratische Ärzte und die Vergangenheitsbewältigung“ mit einer eigenen Geschichtsauffassung und unterstellt dem Verein „leichtfertigen Umgang mit der Geschichte“. Die überwiegende Mehrheit der Ärzte habe nämlich Distanz zum NS-System gehabt, eine gebetsmühlenhaft vorgetragene Auffassung, die allerdings durch die häufige Wiederholung auch nicht glaubwürdiger wird. Die vom Hartmannbund als Replik auf das Vereinsprogramm begonnene Beschäftigung mit der eigenen Geschichte wurde, offenbar wegen ihrer Bedeutung für das Ansehen der Ärzteschaft in der Öffentlichkeit, im Deutschen Ärzteblatt vom 2. Mai 1987 fortgesetzt. In dem ausführlichen Interview mit dem Bundesärztekammerpräsidenten Karsten Vilmar ist aber nicht mehr der Verein das Angriffsobjekt – diese Auseinandersetzung bleibt dem Hartmannbund vorbehalten -, sondern die IPPNW. Anlass ist ein Beitrag des Wiesbadener IPPNW-Mitgliedes Hanauske-Abel in der englischsprachigen Zeitschrift The Lancet (2. August 1986, S. 271 ff.). Auf mehreren Seiten wird in dem Interview erneut die These von der Unschuld des überwiegenden Teils der deutschen Ärzteschaft aufgestellt. Die Unhaltbarkeit dieser Vorstellungen zeigte sich allerdings schon kurz darauf im Rahmen des 90. Deutschen Ärztetages (DÄT) in Karlsruhe, wo zum ersten Mal in der Geschichte deutscher Ärztetage eine Diskussion über die Zeit von 1933 bis 1945 stattfand. Erstmals war ein entsprechender Antrag der oppositionellen Delegierten, wenn auch mit äußerst knapper Mehrheit, angenommen worden. Berücksichtigt man die vorausgegangenen harten und zum Teil sozialdemagogisch ausgetragenen Auseinandersetzungen um eine Strukturreform des Gesundheitswesens mit mehr finanzieller „Eigenverantwortlichkeit“, Risikozuschlag und Aufweichung der Versicherungspflicht, so erscheint die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte nicht mehr nur als akademisches Unterfangen, sondern ist als Hintergrund einer aktuellen Politik des Sozialabbaus unter gleichzeitiger Erhaltung der Privilegien des Ärztestandes zu sehen. Die neu entfachte Diskussion kündigt möglicherweise eine Neuorientierung der Ärzteschaft an, kann Klarheit bringen und Zusammenhänge öffentlich machen.
Ausblick
Die Geschichte des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte ist noch zu kurz, um ein Resümee seiner Wirkung ziehen zu können. Die bisher geleistete Arbeit und die Reaktionen der Öffentlichkeit aber auch der Ärzteschaft bestätigen die Notwendigkeit eines links-alternativen Ärzteverbandes. Die Zuspitzung der sozialen Risiken für wachsende Teile der Bevölkerung verlangt nach Ärztinnen und Ärzten an der Seite dieser Menschen. Die offiziellen Standesvertreter mit ihrer Doppelmoral, ihrem ständigen Rufen nach mehr „Eigenverantwortung“ und „Selbstbeteiligung“ der Patienten, während sie selbst schamlos in die Taschen der Solidargemeinschaft greifen und nach den Zahnärzten die bestverdienende Gruppe aller Selbstständigen darstellen, haben dieser Herausforderung nichts Positives entgegenzusetzen. Ihr Einfluss muss begrenzt werden. Ein Korrektiv ist erforderlich. Der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte kann diese Funktion wahrnehmen, grundsätzliche Alternativen formulieren, sich politisch schärfer, prägnanter in der Öffentlichkeit zu Wort melden, als es den Kammerlisten wegen ihres Eingebundenseins in Körperschaft öffentlichen Rechts möglich ist. Aber auch auf einer weniger augenfälligen Ebene kann der Verein eine positive Rolle spielen, eine Lücke füllen, wie folgendes Beispiel zeigt.
Die National Medical and Dental Association (NAMDA) als Vertreterin der nichtrassistischen Ärzteschaft Südafrikas wandte sich mit der Bitte um Unterstützung bei der Verbreitung ihrer Vorstellungen eines demokratisch verfassten nichtrassischen Gesundheitswesens in Südafrika an den Verein. An welche andere ärztliche Gruppierung hätten sich diese südafrikanischen Kolleginnen und Kollegen auch wenden sollen angesichts der uneingeschränkten Unterstützung des rassistischen südafrikanischen Ärzteverbandes Medical Association of South-Africa (MASA)?
Die Zukunft wird zeigen, ob der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Erfolg oder Misserfolg werden nicht allein von der Aktivität seiner Mitglieder, seinen Arbeitsgemeinschaften und seines Vorstandes abhängen. Ohne eine demokratische Weiterentwicklung der politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland, ohne ein Minimum an politischem Spielraum wird der Misserfolg unvermeidbar sein. Die solidarische Zusammenarbeit des Vereins mit den kritischen, links-alternativen Kräften wird so zur Voraussetzung seines erfolgreichen Wirkens auf dem langen und steinigen Weg gesellschaftlichen Fortschritts. Der Verein wird dabei an die Tradition des Vereins Sozialistischer Ärzte der Weimarer Zeit anknüpfen. Dessen kontinuierliche und erfolgreiche Bündnisarbeit bis unmittelbar vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten – eine der wenigen Ausnahmen unter den durch Zersplitterung gekennzeichneten politischen Verhältnissen gerade auch in der Linken – war ganz wesentlich auf seine strikte Unabhängigkeit von jedweder politischen Partei zurückzuführen. Der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte wird diese Erfahrungen zu beherzigen haben. Die bereits hergestellten Kontakte auf Vorstandsebene zu den Grünen und der SPD werden positive Rückwirkungen sowohl auf den Verein als auch auf die Parteien haben, wenn die für ein erfolgreiches Wirken so notwendige strikte Parteiunabhängigkeit nicht aufgegeben wird. Es wird darauf ankommen, dass es gelingt, diesen Weg beizubehalten.
(Aus: Winfried Beck, Nicht standesgemäß. Beiträge zur demokratischen Medizin, VAS – Verlag für Akademische Schriften, Frankfurt/M 2003, S. 9-23)