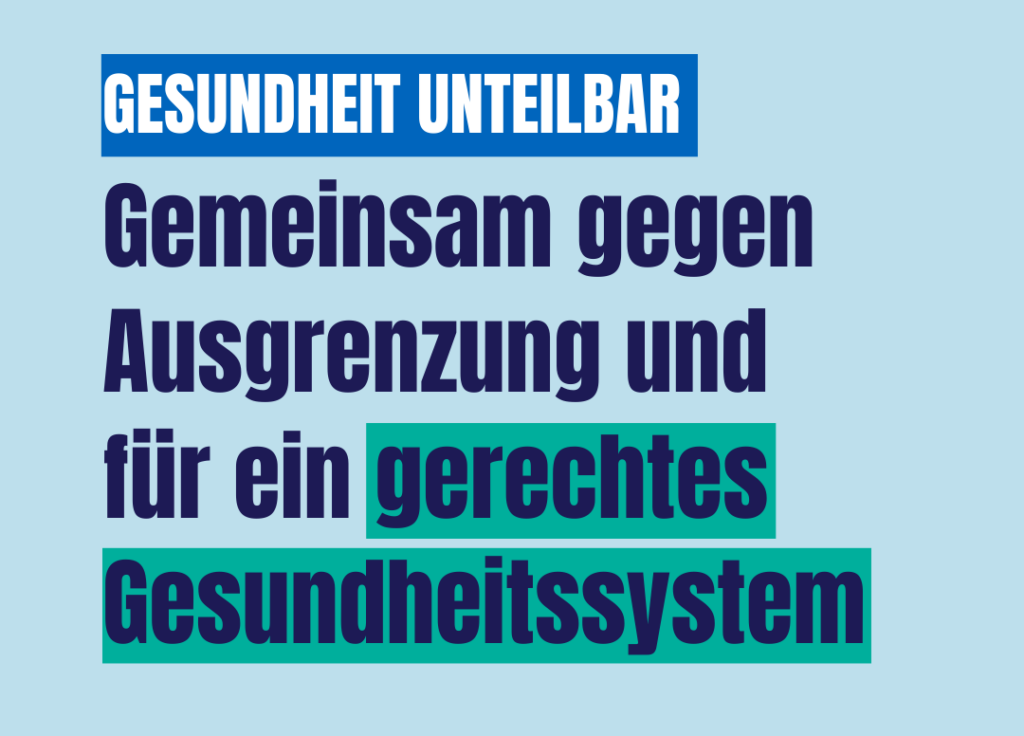Die dem Entwurf zugrundeliegende Definition von Gesundheitsförderung wird bestimmt als „selbstbestimmtes gesundheitsorientiertes Handeln der Versicherten“. Im Gegensatz zur Definition der Ottawa Charta – dem zentralen internationalen Dokument zur Gesundheitsförderung – wird einseitig das “selbstbestimmte Handeln” in den Vordergrund gestellt und auf die Versichertengemeinschaft reduziert.
Aber: Fast 30 Jahre nach der Ottawa Charta von 1986 ist längst in sämtlichen internationalen Diskussionen die Erkenntnis eingekehrt, dass die meisten der für die Gesundheit relevanten Entscheidungen nicht in der Gesundheitspolitik getroffen werden. Die Ottawa Charta versteht Prävention und Gesundheitsförderung daher als gesamtgesellschaftliche Aufgabe – ganz im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Bundesregierung.
Dieser sieht die Finanzierungsverantwortung, Organisation und inhaltliche Ausgestaltung allein in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung verortet. Bund? Länder? Kommunen? Ihnen kommt keine Verantwortung zu, obwohl sie de facto die Rahmenbedingungen für soziale Determinanten der Gesundheit setzen und für die Bedingungen in den relevanten Lebenswelten wie Schulen, Betriebe, öffentliche Räume, letztendlich für die Arbeits- und Lebensbedingungen eine hohe Mitverantwortung tragen.
Die Weltgesundheitsorganisation steht zur Bekämpfung sozialer Ungleichheiten in den Gesundheitschancen – der global und national vorrangigen gesundheitspolitischen Herausforderung – für „Health in all policies“ ein. Dies ist ein sektorübergreifendes Konzept zur Stärkung der Gesundheit in allen für sie relevanten Politikbereichen. In seiner deutschen Variante wird diese weitreichende Strategie mit dem Gesetzentwurf zu „Health in all Selbstverwaltung“ verniedlicht.
Positive Neuerungen
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Nationale Präventionskonferenz, die Erstellung einer Präventionsstrategie und eines regelmäßigen Präventionsberichtes sind Schritte in die richtige Richtung zur Verbesserung der Vernetzung, Koordination, Planung und Durchführung. Leider hat dieses Gremium durch seine Struktur, in der lediglich Vertreter der Sozialversicherungen Mitbestimmungsrecht haben sollen, nur sehr begrenzte Kompetenzen und spiegelt nicht den Anspruch an eine gesamtgesellschaftliche Herangehensweise wider.
Die Rolle der gesetzlichen Kassen
Der Gesetzentwurf verschärft die widersprüchliche Lage, in die die gesetzlichen Kassen durch die vergangenen Gesundheitsreformen versetzt wurden. Sie sollen gemäß dem neuen §20 nicht nur auf Bevölkerungsebene kaum wirksame Individualprävention wie Abnehm-Kurse, Ernährungsberatung etc. anbieten, sondern auch den „Aufbau und die Stärkung von gesundheitsförderlichen Strukturen“ in den Lebenswelten durchführen.
Hier zeigt sich: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Zwar klingt der Gesetzestext, der die „Beteiligung der Versicherten und der für die Lebenswelt Verantwortlichen“ bei der Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen im Setting vorsieht, erst einmal ganz vernünftig. Da die Krankenkassen ohne gesetzliche Grundlage aber gar keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der Verhältnisse in den Lebenswelten wie Schulen, Kindergärten, Kommunen, etc. haben, ist zu erwarten, dass die praktische Umsetzung kaum möglich sein wird.
Das soll sie auch gar nicht! Bei näherer Betrachtung geht es nämlich nicht um die Veränderung der Verhältnisse in den Settings bzw. Lebenswelten, sondern lediglich darum „die Gesundheitsförderung und Prävention insbesondere in den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger zu stärken“. Konkret bedeutet das, dass nicht die Verhältnisse im Setting geändert werden sollen, wie z.B. das Arbeitszeitgesetz konsequenter umzusetzen, sondern dass die Lebenswelt als Zugangsweg für verhaltenspräventive Maßnahmen genutzt werden soll.
Zuckerbrot und Peitsche
Völlig abzulehnen ist jedoch die verbindliche Einführung von Bonus-Systemen – der nicht tot zu kriegenden Schnapsidee jedes marktliberalen Gemüts. Derartige Anreizsysteme sind in der Prävention generell als unethisch, weil diskriminierend, abzulehnen. Nicht erst seit Michael Marmot wissen wir, dass das Gesundheitsverhalten und die Gesundheitsrisiken zwischen den sozioökomischen Klassen ungleich verteilt sind. Auch der Zugang zu Präventionsangeboten in Deutschland ist ungleich verteilt, wie der Präventionsbericht der gesetzlichen Krankenkassen zeigt. Zudem weisen aktuelle Daten darauf hin, dass die gesellschaftliche Ungleichheit von Gesundheitschancen, das heißt die Verbindung von niedrigem sozioökonomischen Status und einem überproportional erhöhten Mortalitätsrisiko und verringerter Lebenserwartung in den vergangenen Jahren in Deutschland sogar zugenommen hat (Lampert & Kroll, 2014).
Vor diesem Hintergrund die besser gebildeten und besser verdienenden Versicherten auch noch zu belohnen, ist zynisch und sendet eine fatale Botschaft, die eher der Disziplinierung und Diskriminierung unterer sozialen Schichten dient als der Stärkung der Gesundheitsförderung.
Partikularinteressen
Einerseits ist begrüßenswert, dass der Gesetzentwurf sich nicht den Forderungen der ärztlichen Standesfunktionäre beugt, die aus eigenem Interesse eine stärkere Rolle im Gesetz fordern und Prävention nicht als gesellschaftliche sondern als “originär ärztliche Aufgabe“ (Frank Montgomery) betrachten. Dennoch haben es die Lobbyisten des Verbandes der privaten Krankenversicherung geschafft, die Einbeziehung der pKV dezidiert offen zu halten – angesichts der großen sozialen Ungleichheit und damit der Gesundheitschancen der pKV-Klientel und der Allgemeinbevölkerung ein fatales Signal des Gesetzgebers.
Fazit
Bei aller Kritik hat sich doch im Bereich der Gesundheitsförderung in Deutschland in den vergangenen Jahren auch sehr viel Positives getan. Gesundheitliche Chancengleichheit hat auf staatlicher wie auch zivilgesellschaftlicher Ebene eine breite Aufmerksamkeit erhalten und es existieren vielversprechende Ansätze auf lokaler und kommunaler Ebene. Die nationale und auch internationale Vernetzung wurde kontinuierlich verbessert. Dennoch bleibt ein spürbarer gesundheitlicher Effekt auf der Bevölkerungsebene weitestgehend aus. Das liegt hauptsächlich daran, dass politische Maßnahmen zur gesundheitlichen Prävention in Deutschland zugunsten von ökonomischen Interessen nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden. Deutschland bleibt z.B. im Bereich der Tabakkontrolle im internationalen Vergleich deutlich zurück. Auch in anderen Ländern positiv erprobte Maßnahmen wie Ampelsysteme für Nahrungsmittel, Zucker- und Fettsteuer oder Werbeverbote für Süßwaren an Kinder werden in Deutschland nicht aufgegriffen. Wohl auch, weil es so verlockend simpel ist, an die Übergewichtigen zu appellieren, nicht so übergewichtig zu sein und den Rauchern zu erzählen, sie sollen nicht so viel rauchen, anstatt der Nahrungsmittel- und Tabakindustrie klare Grenzen zu setzen und das Problem von seinen Ursachen her anzugehen.
Was trotz des neuen Gesetzentwurfes weiterhin fehlt, ist ein integriertes Vorgehen, das die punktuell sinnvollen verhaltenspräventiven Maßnahmen in eine gesamtgesellschaftliche Strategie einordnet.
Das Gesetz trägt keineswegs der Erkenntnis von „Health in all policies“ Rechnung, dass jede politische Entscheidung und Gesetzgebung konkrete Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dementsprechend diese Auswirkungen im Gesetzgebungsprozess durch eine Prüfung (engl. Health Impact Assessment) zu untersuchen sind. Der erwünschte übergeordnete Effekt sollte dabei sein, das Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft zu stärken und konkret aufzuzeigen, wie stark beispielsweise Sozial-, Verkehrs- oder Bildungspolitik sich auf unsere Gesundheit auswirken.
Der aktuelle Gesetzentwurf wird hier wohl kaum die große – dringend notwendige – Wende einleiten. Denn es braucht kein pessimistisches Gemüt, um sich in Sorge auszumalen, welche gewaltige Krankheitslast im Bereich chronischer und psychischer Erkrankungen in Deutschland als Folge der staatlich organisierten Armut in Form der Agenda-Politik und ihrer gesellschaftlichen Folgen in den nächsten Jahren noch ins Haus stehen werden.
Prof. Dr. Wulf Dietrich (Vorsitzender)