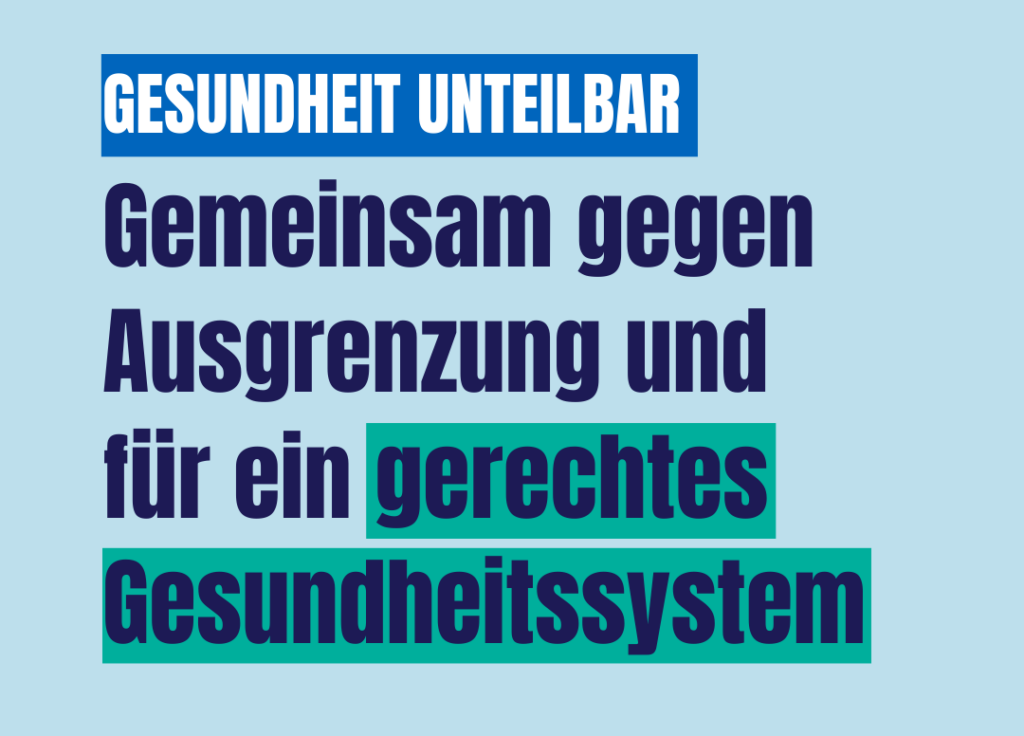Es ist Mittwochabend, neun Uhr im Physiologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Die langen, kahlen Korridore sind dunkel, die Studierenden längst nach Hause gegangen. Nur in Raum D 023 brennt noch Licht. Ein knappes Dutzend junger Menschen sitzt in einem Stuhlkreis, schweigend. Das Plenum der Kritischen Medizin München nähert sich dem Ende. Alle haben jetzt noch einmal die Möglichkeit, das eben Diskutierte Revue passieren zu lassen und Gedanken, die durch die Köpfe schwirren, laut auszusprechen. „Ich bin froh zu sehen, dass ich damit nicht allein bin“, sagt eine Teilnehmerin, die zum ersten Mal dabei ist.
Gemeint ist ein Unbehagen in Bezug auf Missstände im Gesundheitssystem, in Krankenhäusern, aber auch im Medizinstudium. Zeitmangel und Profitorientierung, wenn es um die Behandlung von Patientinnen und Patienten geht. Hoher Leistungsdruck und die Mengen an Lernstoff in der Universität. Fehlender Raum für soziale Fragen. All das prangert die außeruniversitäre Organisation an – und will es verändern. Eine Herkulesaufgabe.
Einige Stunden vor dem Treffen im Institut sind sechs Studierende, alle Anfang bis Ende zwanzig, ins Café am Beethovenplatz gekommen, um zu berichten, was sie teilweise selbst erlebt haben. Amrei Hofacker, David Kamiab Hesari, Theresa Mareis, Julius Poppel, Adrian Lambert und Hannah Kilgenstein betonen immer wieder, dass sie nur repräsentativ für den Rest der Gruppe hier sitzen. Die Kritische Medizin München organisiert sich basisdemokratisch, es gibt keine Anführer, keine Hierarchie. Anders als in der Medizin selbst.
Theresa, 22, mittlerweile im vierten Jahr ihres Medizinstudiums, merkte das bereits im Pflegepraktikum während des ersten Semesters. „Ich wurde von älteren Studierenden und Assistenzärzten ständig von oben herab behandelt. Mir wurde klar gemacht, dass ich nichts kann.“ Es brauche mehr Reflexion in der Medizin insgesamt, sagt Julius, 24. Er rief die Kritische Medizin München vor drei Jahren nach Berliner Vorbild ins Leben. Er sagt: „Mit Hierarchie kommt Macht. Aber eine kritische Hinterfragung dessen, was Macht mit uns macht, gibt es nicht in der Medizin.“
Insbesondere Frauen würden dies zu spüren bekommen. Sexismus im Krankenhaus sei weit verbreitet, sagen die Anwesenden. 80 Prozent der dort Beschäftigten sind weiblich, aber sie arbeiten eben nicht in den führenden Positionen. Die Gruppe will es anders, besser machen, das zeigt sich auch in der Gesprächskultur. Stets wird darauf geachtet, dass allen derselbe Redeanteil zukommt. Die Studierenden unterbrechen sich nicht, und Gegenargumente werden höflich formuliert. Über den Termin für das nächste Plenum wird demokratisch entschieden, und selbst die Moderation wechselt sich ab.
Für so etwas bleibe im stressigen Klinikalltag oft keine Zeit, sagt Adrian Lambert, 29. Er weiß, was es bedeutet, auf der anderen Seite zu stehen und Anweisungen zu erteilen. „Ich bin schon selbst einmal in die Situation hineingerutscht, in der ich jemandem, der mir unterstellt ist, etwas Unsanftes gesagt habe“, erzählt Adrian. Die Gruppe ist für ihn der Ort, um solche Erlebnisse aufzuarbeiten und Wege zu finden, es in Zukunft besser zu machen. Dazu wollen sie auch die medizinische Lehre anpassen: Sie bereite junge Menschen nicht hinreichend auf die ethischen Herausforderungen des Arztberufs vor, so die Studierenden.
Medizinische Lehrpläne umschreiben zu lassen, ist ein zähes Unterfangen. Die Universitäten können darauf oft selbst nur wenig Einfluss nehmen. Das Studium ist als Staatsexamen organisiert, und es bedarf großer bürokratischer Hürdenläufe, die Inhalte anzupassen. Die Mitglieder der Kritischen Medizin München würden sich schon über Unterstützung bei freiwilligen Zusatzveranstaltungen freuen. Doch Verantwortliche hätten abgewunken, erzählen sie, etwa beim Thema Rassismus. Auf Anfrage sagt hingegen Martin Fischer, Studiendekan der Humanmedizin an der LMU: „Themen sozialer Ungleichheit insbesondere zu Über- und Unterversorgung sollten stärker in das Studium integriert werden.“ Wer von Diskriminierung betroffen sei, könne sich „jederzeit an die Studiendekane unserer Fakultät wenden“.
Dieses Angebot reicht den Studierenden der Kritischen Medizin München nicht aus. Also setzt die Gruppe ihre Ideen selbst um. Regelmäßig organisiert sie medizinhistorische Stadtrundgänge durch das Klinikviertel an der Theresienwiese und klärt über die komplizenhafte Rolle der Münchner Medizin zur Zeit der NS-Diktatur auf. Hannah und Adrian haben eine Veranstaltung für Medizinstudierende zu mentaler Gesundheit veranstaltet. Das ändere zwar nichts an den Verhältnissen an der Universität, schärfe aber den Blick für die gesellschaftliche Verantwortung, die eine jede Studentin, ein jeder Student später einmal tragen wird.
Ein Projekt, das der Gruppe sehr am Herzen liegt, ist das Heft „Diskriminierung in der Medizin“. Auf 50 Seiten beleuchten sie Benachteiligung in der Behandlung und Forschung. Ein Beispiel: Viele Medikamente werden kaum an Frauen erprobt. Das häufig verschriebene Herzmedikament Digoxin etwa verkürzt unter bestimmten Umständen das Leben von Frauen, das von Männern aber nicht. Auch sterben Frauen häufiger an einem Herzinfarkt, da ihre Symptome andere sind, die zu spät erkannt werden.
Die Studierenden treten außerdem für eine Medizin ohne Profitdruck ein. Amrei, 23, berichtet von der kardiologischen Station eines Kreiskrankenhauses. Dort litten viele ältere Menschen unter mehreren Erkrankungen gleichzeitig: Herzerkrankungen, Venenerkrankungen, Diabetes. Nach einer Herzkatheter-OP oder ähnlich teuren Behandlungen wurden sie schnell nach Hause geschickt, kamen aber nach kurzer Zeit wieder. Das Problem: Um Ursachen von Erkrankungen auf den Grund zu gehen, etwa die Ernährung oder die Wohnsituation, reicht weder Zeit noch Personal. Schuld daran, so sehen es die Studierenden, haben die sogenannten DRG-Fallpauschalen: Früher wurden Krankenhäuser nach der Aufenthaltsdauer der Patienten bezahlt, heute nach Art und Zahl der Diagnosen.
Die Kritische Medizin München will eine Plattform sein, in der solche Themen diskutiert werden dürfen, denn im Studium selbst ist dafür keine Zeit. „Ich dachte immer, ich bin alleine damit, dass ich es schlecht finde, wie es im Krankenhaus abläuft, wie mit kranken Personen umgegangen wird und wie das System aufgebaut ist“, sagt Amrei. Hier hat sie endlich Verbündete gefunden. Wie Hannah, 28, zum Beispiel. „Ich fand das Studium am Anfang ganz schrecklich“, erzählt sie. „Die Atmosphäre ist erbarmungslos. Der Druck ist sehr groß und wird aktiv aufrechterhalten. Man weiß immer zu wenig, man ist immer zu schlecht.“
Dieses Studien- und Arbeitsklima hat Folgen: 27 Prozent der Medizinstudierenden zeigen depressive Symptome, elf Prozent haben Suizidgedanken, zeigt eine internationale Studie von 2016. „Bei Ärztinnen und Ärzten selbst ist das Erkrankungsrisiko, gerade durch die hohe Belastung, deutlich höher als in der übrigen Gesellschaft“, sagt Adrian. Ein Paradox, dem im Studium selbst kein Platz eingeräumt wird.
Armut, Geschlecht, soziale Herkunft: Es gibt viele Faktoren, die Menschen krank machen können. „Das Krankenhaus existiert nicht außerhalb der Gesellschaft. Alle sozialen Probleme finden sich auch genau dort wieder“, sagt David, der gerade sein Praktisches Jahr absolviert und erst durch die Gruppe einen Weg gefunden hat, sein brennendes Interesse für politische Fragen in medizinischen Zusammenhängen weiterzuverfolgen.
Die Studierenden glauben an ihre Vision einer besseren Medizin. Eine Vision, die sowohl die Beschäftigten im Gesundheitswesen als auch Patientinnen und Patienten entlastet. „Ich möchte den Menschen nicht erst dann teuer operieren müssen, wenn es eigentlich schon zu spät ist“, sagt Theresa. „Stattdessen sollte mehr für die Prävention von Erkrankungen getan werden.“ Viele wünschen sich auch eine offene Fehlerkultur. „Im klinischen Alltag gilt die Devise: Du machst keine Fehler“, erzählt David. Diejenigen, die am Ende am meisten unter solchen Strukturen leiden, sind die Patienten. Adrian hat einen konkreten Vorschlag: Supervision, also der gemeinsame Austausch über das Geschehene im Behandlungsteam, als Teil der bezahlten Arbeitszeit. Eine simple Idee. Aber: „Das passiert derzeit einfach nicht in ausreichendem Maße“, sagt er.
Durch ihr Engagement haben sich die jungen Mediziner die Möglichkeit geschaffen, dem weit verbreiteten Gefühl der Ohnmacht zu entkommen. Eine Möglichkeit, die ihnen das Studium nicht geben will – und die doch so wichtig erscheint. Denn die jungen Menschen wollen vor allem eines: bessere Ärztinnen und Ärzte sein.