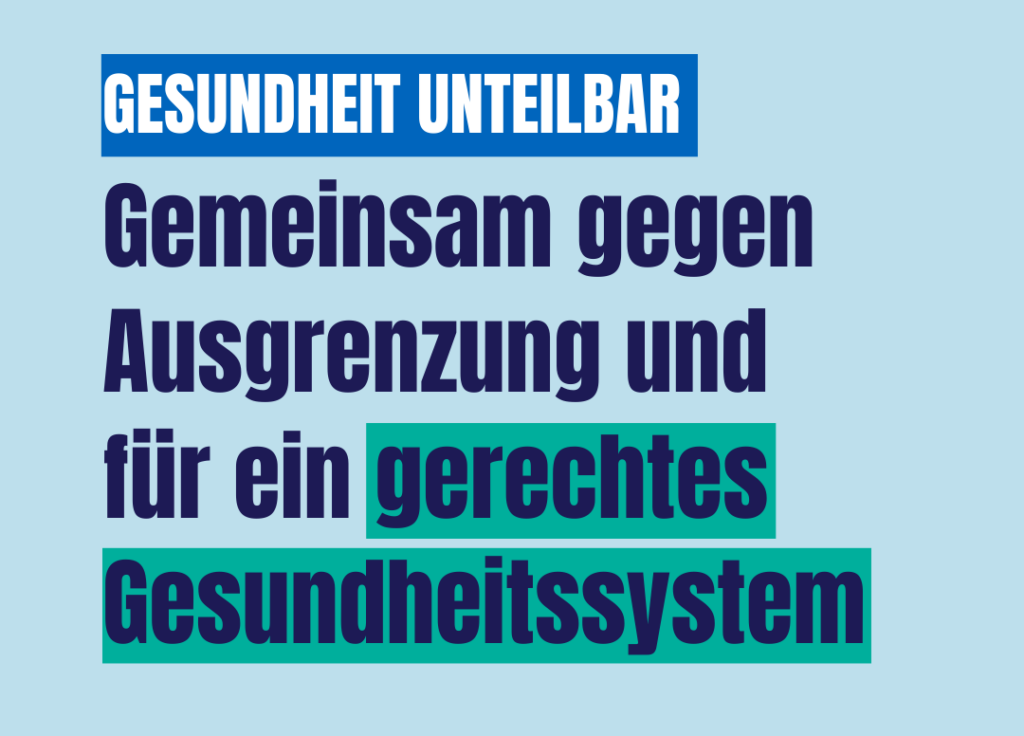aus der Gesundheit braucht Politik 3/2023
von Andreas Heinz
In der Psychiatrie ist die Frage der Normierung, des »Normalen« noch einmal heikler als in der somatischen Medizin, da der Einfluss gesellschaftlicher Normen und damit einhergehend gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse hier unmittelbarer ist.
Wenn wir von Normierung in der Medizin sprechen, denken wir zuerst an etwas Alltägliches: Normwerte für bestimmte Laborparameter beispielsweise, deren Überschreitung einen krankhaften Zustand des Organismus anzeigen kann. Lässt sich dieses Vorgehen auf alle gesundheits-relevanten Fragen übertragen? Können wir also Normwerte für Körpergröße und Gewicht ebenso definieren wie für die Kalorienzufuhr, die nicht überschritten werden sollte, wenn wir keine Adipositas riskieren wollen, den empfohlenen Umfang täglicher Bewegung, die Qualität des Schlafes oder das Ausmaß des Grübelns, das uns davon abhält? Ist nicht jede Krankheit eine Normabweichung und besteht die Schwierigkeit vielleicht einfach nur darin, dass sich Normen über Leberfunktionswerte leichter definieren lassen als solche für Grübeln, Glücksspielen oder Trinken? Wäre uns also damit geholfen, dass wir eine große Gruppe von Menschen diverser Herkunft im Längsschnitt untersuchen und statistische Abweichungen nach oben und unten erfassen, die dann Anzeichen einer Normabweichung und damit einer Erkrankung sind?
Gegen diesen Ansatz wandte aber bereits Karl Jaspers (1946: 653) ein, dass zum Beispiel Karies zu seiner Zeit durchaus normal war, aber dennoch als Krankheit galt. Was also statistisch normal ist, muss deswegen noch lange nicht gesund sein. Hinzu kommt noch ein anderer Unterschied: Normwerte bestimmter Organfunktionen lassen sich statistisch durchaus bestimmen, auch wenn sogar in diesem Bereich die Festlegung der Werte, die etwa beim Blutdruck noch als gesund gelten, geändert werden kann. Normwerte menschlicher Verhaltensweisen sind dagegen in noch viel stärkerem Umfang gesellschaftlich und geschichtlich geprägt und unterliegen einem ständigen Wandel. Man denke nur an die ständigen neuen Weltrekorde im Sport – was vor 20 Jahren als Spitzenwert galt, ist heute in fast allen Sportarten längst obsolet. Was bezüglich der Überschreitung von Leistungsgrenzen im Sport gilt, gilt noch viel mehr für Verhaltensweisen, die sich nicht durch Training des Körpers, sondern durch emotionale und kognitive Aspekte auszeichnen. So ist die durchschnittliche Leistung in Intelligenztests seit 1945 in allen Regionen dieser Welt um circa eine Standardabweichung gestiegen (Flynn, 2012), allerdings offenbar ohne dass die Welt in irgendeiner Hinsicht klüger und besser geworden ist – ein Argument gegen die Bedeutung, die diesem im zeitlichen Wandel befindlichen Testwert in vielen rassistischen Theorien zugeschrieben wird. Insgesamt neigt das menschliche Leben dazu, Grenzen zu überschreiten und Normen immer wieder neu zu definieren (Canguilhem, 2016). Zwar gibt es Gesellschaften, die mehr auf Bewahrung tradierter Abläufe und Verhaltensmuster setzen als andere, aber auch hier ist das Bild viel bunter als früher oft postuliert (Graeber und Wengrow, 2023). Normal heißt also nicht gesund und Gesundheit wird nicht durch den Durchschnitt definiert (für eine alternative Theorie gesunden Verhaltens siehe Heinz, 2016).
Aber welche Bedeutung hat denn die Diskussion über Normen und Nominierung, die auch im Bereich der Medizin immer wieder hohe Wellen schlägt? Der Philosoph Michel Foucault wies darauf hin, dass sich Machtverhältnisse (»die Macht«) auf die »Disziplinierung« der Körper und die »Regulierung« der Bevölkerung (inklusive ihrer Sexualität und Fortpflanzung, Hygiene und Kinderpflege) stützen. Er sprach von einer »Normalisierungsgesellschaft«, in der sich die »Norm der Disziplin und die Norm der Regulierung miteinander verbinden« (Foucault, 2016: 296-299). Das erinnert an Antonio Gramscis berühmte Aussage, der »Staat« sei »politische Gesellschaft + Zivilgesellschaft, das heißt Hegemonie gepanzert mit Zwang« (Becker et al., 2013: 75). Unter Hegemonie wird die gesellschaftlich vorherrschende Sicht auf die Welt verstanden, die wirkmächtig genug sein muss, einen Großteil der Bevölkerung dazu zu bringen, sich »von selbst« an den herrschenden Normen zu orientieren, zu messen und sich ihnen zu unterwerfen.
In die Konstruktion dieser Normen, gerade im Bereich der Diskussion über gesundes und ungesundes Verhalten, gehen aber tradierte und häufig unreflektierte Werte und Haltungen ein, die sich in Europa und Nordamerika in Jahrhunderten des transatlantischen Sklavenhandels, des Kolonialismus und der post-kolonialen Wirtschafts- und Ausbeutungsverhältnisse gebildet haben. Dies lässt sich zeigen für die Entgegensetzung von vermeintlich »primitiven« Begierden einerseits und einer rationalen Selbstbeherrschung andererseits, die in Suchterkrankungen verloren gehen soll. Koloniale Werte und Haltungen finden sich aber auch im Verständnis der schizophrenen Psychosen, die durch den postulierten Verlust des »realitätskonformen« Denkens und die Freisetzung eines »magischen« Wunschdenken gekennzeichnet sein sollen, das sich auch bei den angeblich primitiven Bewohnern der (ehemaligen) Kolonien finde (Überblick und Kritik in Heinz, 2023).
Nachwehen dieser Theorien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts und damit zu Zeiten des europäischen Kolonialismus und Imperialismus erarbeitet wurden, lassen sich bis heute in unseren Erklärungen psychischer Krankheit und Gesundheit nachweisen. Auch im heutigen Kapitalismus müssen Begierden gezügelt und Lüste und Unlust kontrolliert werden – allerdings ist an die Stelle der Repression, der Unterdrückung und Verdrängung die sublime Kontrolle, die Optimierung des Umgangs mit Gefühlen, Stimmungen und Wünschen getreten. Unterstützt wird die optimierte Selbstkontrolle durch moderne Technologien: Wir alle können jederzeit messen und direkt an die globalen Konzerne der Digitalisierung melden, ob wir gut genug schlafen, genügend Schritte am Tag tun, wie stark unser Puls dabei angestiegen ist, welche Webseiten wir besuchen und an welchen Orten wir uns aufhalten, und ob wir dabei glücklich, zufrieden und entspannt sind oder nicht. In ungebrochenen Traditionen kultureller Aneignung vereinfachen wir komplexe Meditations-Praktiken zu handlichen Achtsamkeitsübungen, die unser diszipliniertes Tun weiter optimieren sollen. Und wir erarbeiten immer neue Krankheitsbilder für leidenschaftliches, norm-abweichendes Verhalten, das unser reibungsloses Funktionieren im Kapitalismus stören könnte: »Kaufsucht«, »Sexsucht«, »Arbeitssucht«, um nur einige zu nennen. Allen diesen vermeintlichen Süchten ist gemeinsam, dass sie einen Aspekt der eigentlich sozial gewünschten Verhaltensweisen (Konsum, Fortpflanzung, Arbeit) so ins Extrem steigern, dass das reibungslose Funktionieren in der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Das achtsame Individuum hat also ständig auf seine Grenzen zu achten, es soll konsumieren, aber nicht so, dass es sich rettungslos verschuldet; es soll sich fortpflanzen, damit die Renten gesichert sind, aber sich nicht in unproduktiven Begierden verlieren.
Aber ist die Auseinandersetzung um die »Arbeitssucht« nicht gerade ein Versuch, gegenüber einem umfassenden Selbstverwertungsdruck eigene Ziele zu erarbeiten und der traditionellen Disziplinierung etwas entgegenzusetzen? Normalisierungsversuche würden nicht verfangen, wenn sie uns nicht auch immer wieder die Hoffnung bieten würden, dass die Unterwerfung unter die Norm in Wirklichkeit eine Befreiung darstelle. Die Auseinandersetzung um exzessives Arbeiten könnte also emanzipatorischen Zielen dienen. Dann müsste sie aber unter einer Perspektive geführt werden, die das verzweifelte Bemühen um hinreichendes Einkommen von Menschen weltweit berücksichtigt, die unter oder am Existenzminimum leben, und den Zwang zur Lohnarbeit thematisieren. Und sie dürfte sich nicht einfach darin erschöpfen, das optimale Maß an Freizeit zu definieren, das wir entgegen unserer »Arbeitssuchtstruktur« einhalten müssen, damit wir am nächsten Tag umso erfolgreicher arbeiten können. Selbst-Optimierung mit Bezug auf noch so modisch verbrämte Normen ohne Bemühung um Änderung der herrschenden Verhältnisse dient immer nur deren Befestigung.
Andreas Heinz ist Arzt und Philosoph und arbeitet in der Charité als Klinikdirektor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Literatur
Becker, Lia / Candeias, Mario / Niggemann, Janek; Steckner, Anne: Gramsci lesen, Hamburg 2013
Canguilhem, Georges: Das Normale und das Pathologische, Berlin 2017
Gräber, David / Wengrow, David: Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit, Stuttgart 2023
Heinz, Andreas: Psychische Gesundheit – Begriffe und Konzepte, Stuttgart 2016
Heinz, Andreas: Das kolonialisierte Gehirn, Berlin 2023
Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft, Berlin 2016
Jaspers, Karl: Psychopathologie, Berlin / Heidelberg 1946
Flynn, James R.: Are we getting smarter? Rising IQ in the Twenty-First Century, Cambridge 2012