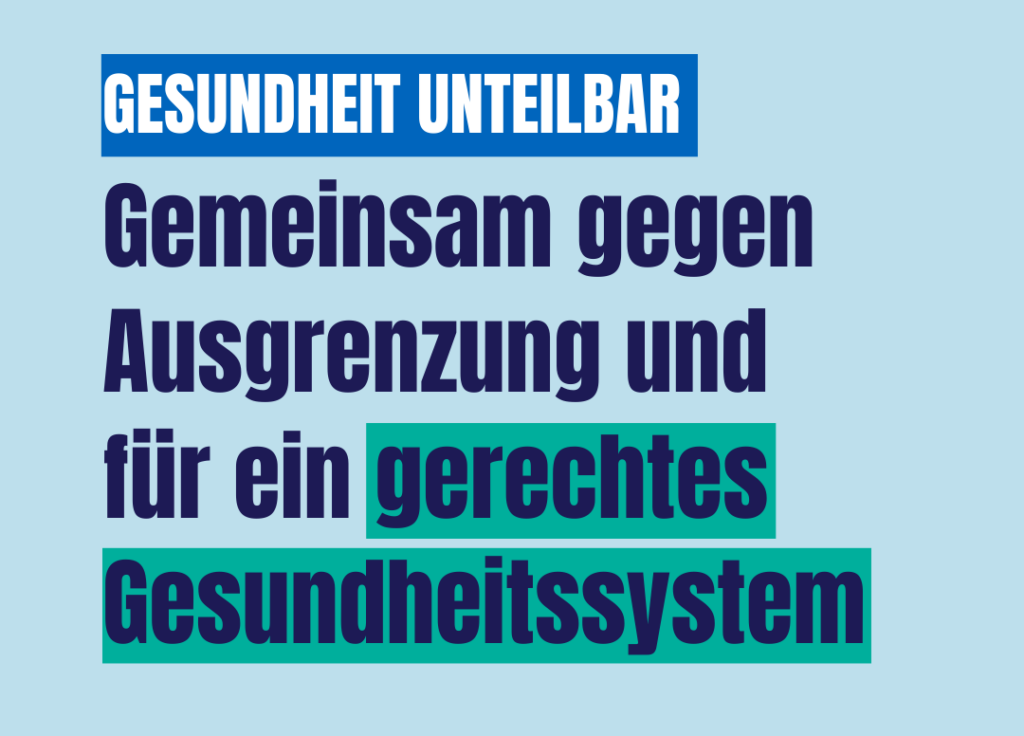von Bernhard Winter
Die Ärztekammern und insbesondere die Standesorganisation sind auch auf dem Marburger Kongress 1973 vielfältig kritisiert worden. Zusammenfassend wurde beschrieben, dass dem Ständischen immanent sei, »gegen gesellschaftlichen Fortschritt und Entfaltung der Demokratie gerichtet« zu sein.
Das Aktionsprogramm des Initiativausschusses, der den Kongress vorbereitete, forderte daher auch:
Eine freiwillige Mitgliedschaft statt Pflichtmitgliedschaft in den Ärztekammern, die Berufsgerichtsbarkeit solle in die allgemeine Rechtspflege überführt und die Fort- und Weiterbildung öffentlich geregelt und kontrolliert werden
Die Umsetzung dieser Forderungen wäre de facto einer Auflösung der Kammern gleichgekommen. Für die Auflösung der Ärztekammern und auch der KVen gab es damals zahlreiche Argumente – nicht zuletzt ihr damals vollkommen ungebrochenes Verhältnis zur NS-Vergangenheit.
Aber was tun, wenn man Zwangsmitglied ist und nicht die politische Macht hat, die Ärztekammern aufzulösen? Zahlreiche linke Ärztinnen und Ärzte versuchten in dieser Situation tiefer in die Kammern einzudringen, sich wählen zu lassen, politische Ämter zu besetzen, um darüber die Kammern zu verändern. Wenn wir nicht rauskönnen, müssen wir reingehen, war die Devise. Zumindest was das Eindringen und Besetzen von politischen Ämtern in den Kammern angeht, war die Ärzteopposition recht erfolgreich. Als erste Liste gelang es der hessischen Liste Demokratischer Ärzte LDÄ 1976 mit 10,6% der Stimmen in die Kammer einzuziehen. In den folgenden Jahren zogen auch in allen anderen Ärztekammern der alten BRD – mit Ausnahme Schleswig-Holsteins – oppositionelle Listen ein. In manchen Kammern konnten sie ihre Position in den folgenden Wahlen ausbauen und wurden stärkste Fraktion (Hessen, Hamburg, Berlin …). Diese Entwicklung blieb allerdings auf die alte Bundesrepublik beschränkt. In den neuen Bundesländern haben sich nie oppositionelle Listen etablieren können. 1987 wurde Ellis Huber als Vertreter der FrAktion Gesundheit in Berlin erster und bisher einziger Ärztekammerpräsident, der von einer oppositionellen Liste gestellt wurde. Auffallend ist weiterhin aber auch, dass es im KV-Bereich nie eine relevante linke Opposition gab. Offensichtlich sehen auch linke Niedergelassene ihre ökonomischen Interessen durch professionelle Berufsverbände besser vertreten.
Was waren Inhalte und Ziele der oppositionellen Listen? Zentral waren die Demokratisierung der Kammern mit transparenten Strukturen und finanziellem Gebaren, sowie die Aufarbeitung der Rolle der verfassten Ärzteschaft in der NS-Zeit. Wichtig waren weiterhin die Ablehnung einer kommerzialisierten Medizin und Förderung solidarischer Strukturen im Gesundheitswesen sowie Streichung des § 218 und Gleichberechtigung von Ärztinnen. Die Militarisierung des Gesundheitswesen wurde abgelehnt. Umweltmedizin sollte in der Weiterbildung etabliert werden.
Dies sind nur einige Beispiele. Weitere Forderungen der Friedens-, Anti-AKW- und Frauenbewegung wurden aufgenommen und in den Kammern diskutiert-
Kannte man die Standespolitiker bisher eher aus den Medien, so waren die Delegierten jetzt mit den meist männlichen Vertretern von Standesorganisation konfrontiert, die unverhohlen ihr reaktionäres Gesicht zeigten. Nicht wenige hatten eine NS-Vergangenheit. Von Anfang an wurden die oppositionellen Listen ausgegrenzt und an ihrem Mitwirkungsmöglichkeiten systematisch behindert. Dies änderte sich erst ganz allmählich.
Dennoch ist evident, dass sich die Kammern in den letzten 40 Jahren erheblich verändert haben. Die NS-Vergangenheit ist weitgehend aufgearbeitet. Der Anteil von Frauen als Delegierte oder in Funktionen ist deutlich gestiegen, wenn auch im Anteil noch nicht der Mitgliedschaft in den Kammern entsprechend. Umweltausschüsse gehören heute zum Standard. Viele Kammern vertreten heute in Fragen der medizinischen Versorgung von Geflüchteten vernünftige Positionen. Alle Kammern haben Menschenrechtsbeauftragte. Das Diskussionsklima in den Kammern hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Auch werden auf dem DÄT zuweilen Anträge von oppositionellen Delegierten angenommen, i.d.R. aber nur dann, wenn ökonomische Interessen von Ärzt*innen nicht berührt werden.
Es wäre unverfroren, diese Änderungen ausschließlich auf das Wirken der Listen zurückzuführen. Andere Faktoren sind sicherlich entscheidender. Die Restaurationsphase der BRD wurde in den 70er Jahren abgeschlossen. Es folgte ein von den 1968ern ausgehender gesamtgesellschaftlicher Modernisierungsschub, der auch die Ärzteschaft miteinbezog. Die NS-Generation trat auch in den ÄK altersbedingt ab. Neoliberale Positionen wurden später in der Gesellschaft hegemonial und untergruben ebenfalls das Standesdenken. Die demokratischen Listen haben allerdings wichtige Diskursfelder zu Themen wie soziale Medizin, Menschenrechte, Medizin und Umwelt, pharmaunabhängige Fortbildung, Rassismus im Gesundheitswesen u.ä. eröffnet. Ämterfilz, Ämterhäufung und Patronage wurden angegangen. Das Zivilschutzgesetz, das eine Militarisierung des Gesundheitswesens beinhaltete, wurde auch über Initiativen in den Kammern verhindert. Diese Themen wurden oft hartnäckig und mit großen Engagement teilweise über Jahrzehnte verfolgt. Dies sollte bei aller Kritik keineswegs unterschätzt werden.
Auf der anderen Seite haben sich auch die Standesorganisation verändert. Am deutlichsten wird dies vielleicht am Marburger Bund, der aber dennoch weiterhin eine ständische Gewerkschaft geblieben ist. Die oppositionellen Listen dienten bei der Transformation dieser Verbände ungewollt als Katalysator, was die Themensetzung und die Demonstration eines anderen Politikstils anging.
Heute gibt es nur noch in einigen wenigen Kammern (Berlin, Hessen, Baden-Württemberg, München) Listen, die sich einer sozialen Medizin verschreiben. Oppositionell will man nicht mehr unbedingt sein. Konstruktive Mitarbeit ist gefragt. Dabei entsteht allerdings ein Anpassungssog seitens der Kammern, der mit Posten und Pöstchen sowie anderen Anerkennungen untermauert wird.
Dagegen ist der Kontakt der Listen zu sozialen Bewegungen wie der Krankenhausbewegung weitgehend verloren gegangen. Fundierte gesundheitspolitische Diskussionen finden eher selten statt. Das kritische Umfeld, das für uns früher selbstverständlich war, ist weggebrochen. Für die Liste in Hessen z.B. ist der vdää* kein Bezugspunkt mehr. Wie sich umgekehrt der vdää* nicht für die Listen interessiert.
War es das also mit linken Listen in den Ärztekammern? Wir schließen dieses Kapitel ab und wenden uns anderen, hoffentlich spannenderen Themen, zu.
Dafür sprechen zudem noch zwei weitere Beobachtungen: Erstens verlieren die Ärztekammern in der öffentlichen Wahrnehmung rapide an Bedeutung. Am augenfälligsten wird das an der medialen Berichterstattung über den Deutschen Ärztetag, die praktisch nicht mehr stattfindet. Hier ist keine Trauerarbeit angesagt. Weiterhin haben sich die Kammern mit ihrer standespolitischen Verbohrtheit in gesundheitspolitischen Fragen soweit isoliert, dass sie von politischen Entscheidern oftmals nicht mehr als Gesprächspartner wahrgenommen werden. Zweitens gibt es auch in anderen Organisationen, selbst wenn sie ständisch geprägt sind, zahlreiche Einzelpersonen, die in den Kammern vernünftige Arbeit leisten.
Auch wird die Haltung, das Kapitel Kammerarbeit zu beenden, durch eine linke Kritik am Parlamentarismus und einem daraus abgeleiteten Absentismus befördert. So richtig das alles ist, möchte ist dennoch eine andere Perspektive gegenüberstellen.
- Wir sind auf absehbare Zeit weiterhin Zwangsmitglieder in den Kammern. Warum sollten wir es zulassen, dass andere in unserem Namen ihre ständische Stimme erheben? Wenn auch diese Stimme nicht so bedeutungsvoll ist wie früher.
- Bei allgemeiner politischer Regression ist nicht zu erwarten, dass diese vor den Kammern halt macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass der zivilisatorische Lack in den Kammern besonders dick aufgetragen ist. Sollen wir da den Rechten widerspruchslos das Feld überlassen?
- In den nächsten Jahren steht ein Umbau der ambulanten Versorgung an, dabei wird Interprofessionalität und wie sie organisiert ist, eine zentrale Rolle spielen. Wo ist außerhalb des Kammerrahmens der Ort zu erklären, welche Chancen dies für ein besseres Arbeiten von Ärzt*innen und eine bessere Patientenversorgung beinhaltet?
- Eine Remilitarisierung des Gesundheitswesens wird gerade propagandistisch zumindest in der hessischen Kammer vorbereitet. Sollen wir das einfach hinnehmen?
- Wer stärkt in den Kammern den Kolleg*innen den Rücken, die juristisch verfolgt werden, da sie sich vor kranke Menschen, die abgeschoben werden sollen, stellen?
- Wer hinterfragt kritisch die gängigen Positionen zur Klimakrise?
Dies sind aus meiner Sicht nur einige wenige Themen, wo Kammerarbeit für linke Politik hilfreich und sinnvoll sein könnte. Um es mit einem kommunistischen Klassiker zu sagen, es gibt noch viel Ständisches zu verdampfen. Ein Reload der Kammerarbeit ist aus meiner Sicht durchaus zu erwägen. Für mich persönlich wäre dabei unabdingbar, dass der Blick dabei auf ein anderes zukünftiges solidarisch verfasstes, partizipatives Gesundheitswesen gerichtet ist. Großartig wäre es, wenn die Listen wieder zu »Hechten im Karpfenteich« mutieren würden, um Winfried Beck zu zitieren.
Ein solidarisch-demokratisches, nicht kommerzielles Gesundheitswesen muss auf vielen Ebenen erkämpft werden, wenn es sein muss, auch in den Kammern. Lasst uns die Arbeitsfelder, in denen wir arbeiten, dialogisch eng verknüpfen und scheuen wir nicht die Mühen der Ebene.
Bernhard Winter ist Mitglied der Vorstände von vdää* und Solidarischem Gesundheitswesen sowie Delegierter in der Landesärztekammer Hessen