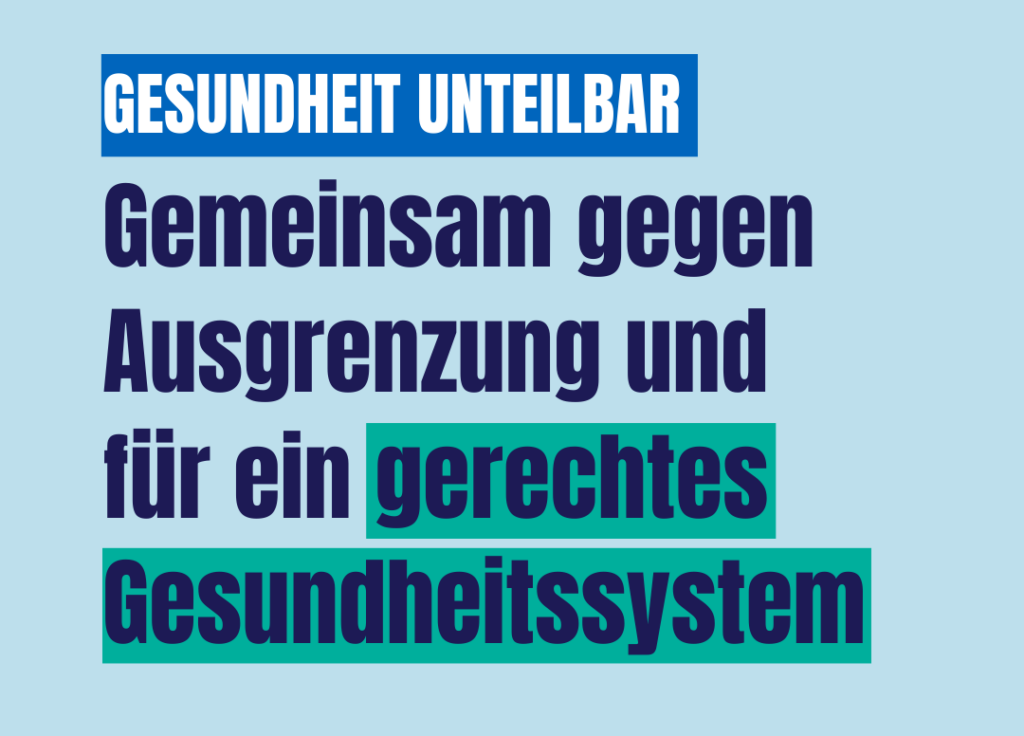aus: „Nicht standesgemäß. Beiträge zur demokratischen Medizin“, Frankfurt/M 2003, S. 107-121
Das Verhältnis der Ärzte zum Krieg ist von jeher widersprüchlich. Die Hilfe für die Opfer von Kampfhandlungen bewirkt beim militärischen Personal immer auch die Wiederherstellung der Kampffähigkeit und ist damit sogleich die Voraussetzung zur Fortsetzung des Krieges. Der hippokratische Eid mit seiner Verpflichtung zur Hilfe unter allen Bedingungen löst diesen Widerspruch nicht auf. Medizin kann so lange missbraucht werden, wie ärztliches Handeln in politikfreiem Raum stattfindet, wie Ursachen für die Notwendigkeit medizinischer Hilfe nicht erkannt, nicht beurteilt, nicht gewertet werden. Auch die scheinbar unpolitische Hinnahme menschenfeindlicher Politik und das Zurückziehen auf rein ärztlich helfende Tätigkeit führt de facto zu einer Unterstützung der jeweiligen Politik.
Die Medizin während des Nationalsozialismus steht hierfür als warnendes Beispiel. Ärzte waren ganz wesentlich an den Vernichtungsprogrammen gegen Juden, Roma und Sinti, politische Gegner, bei der Ausmerze Kranker und Behinderter beteiligt. Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse wurden für die Erhöhung der Kampfkraft der deutschen Wehrmacht genutzt, waren Voraussetzung für die Entwicklung biologischer und toxischer Waffen. Der Nürnberger Ärzteprozess vom Dezember 1946 bis Juli 1947 offenbarte eine bis dahin nicht gekannte Deformierung ärztlicher Ethik als Instrument faschistischer Politik. Die 350 nachgewiesenen Medizinverbrechen wurden durch das Mitwirken, die stillschweigende Duldung, die allgemeine Akzeptanz sozialdarwinistischer und rassehygienischer Prinzipien in der Ärzteschaft und der Bevölkerung erleichtert. Nicht nur die einzelnen Handlungen der angeklagten Ärzte schockierten die nationale und internationale Öffentlichkeit, sondern vor allem die Unterordnung ethischer Prinzipien unter berufsständische Interessen, die Unterwerfung des ärztlichen Gewissens unter die Ziele der faschistischen Staatsführung.
Nach dem Ende der NS-Herrschaft sollte auch in der Medizin ein Neuanfang gemacht werden. Schonungslos sollten die Vergehen aufgedeckt werden, personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen werden. Angesichts des mittlerweile erfolgten militärischen Einsatzes der Atombombe waren die Bedingungen medizinischer Hilfe im Kriegsfall grundsätzlich anders geworden. Das Ausmaß der Zerstörungskraft und die Folgen der Radioaktivität ließen nach allgemeinem Verständnis einen kommenden Krieg als nicht mehr führbar oder gewinnbar erscheinen. Wirksame medizinische Hilfe ist im Atomkrieg unmöglich geworden für militärisches Personal gleichermaßen wie für die Zivilbevölkerung.
Die Ärzteschaft hatte sich nach 1945 dieser veränderten Situation zu stellen. Dabei stellte sich als großes Hindernis heraus, dass nur wenige Ärzte nicht der Ideologie der Nationalsozialisten gefolgt waren, geschweige denn Ihr widerstanden hatten. So wurden bei der Errichtung der ärztlichen Selbstverwaltungsorgane, der Landesärztekammern und der Kassenärztlichen Vereinigungen auf nationalsozialistisch denkende Arzte zurückgegriffen. Das Ergebnis dieser verhängnisvollen Entscheidung zeigte sich bereits bei der Auswertung des Nürnberger Ärzteprozesses. Die nach der Auflösung der Reichsärztekammer 1946 gegründete „Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Ärztekammern“ hatte nach langer vergeblicher Suche nach einem prominenten Prozessbeobachter schließlich den Privatdozenten Alexander Mitscherlich und den Medizinstudenten Fred Mielke mit der Auswertung der Prozesse für die Arbeitsgemeinschaft beauftragt (Mitscherlich & Mielke 1978). Auf den Zwischenbericht „Das Diktat der Menschenverachtung“ erfolgte eine für die beiden Autoren völlig unerwartete Reaktion. Proteste prominenter Vertreter des ärztlichen Berufes häuften sich: „Die Anschuldigungen gegen uns nahmen schließlich ein groteskes Ausmaß an, und man konnte in der Folge manchmal glauben, wir hätten das alles, was hier verzeichnet ist, erfunden, um unseren ehrwürdigen ärztlichen Stand zu erniedrigen“ (ebd., 14). Dennoch setzten sie die Arbeit fort und lieferten 1949 10 000 Exemplare ihres Schlussberichts zur Verteilung an die deutsche Ärzteschaft an die Arbeitsgemeinschaft aus. Die darauf folgende Reaktion war noch überraschender als bei dem Zwischenbericht. „Nahezu nirgends wurde das Buch bekannt. Keine Rezensionen, keine Zuschriften aus dem Leserkreis; unter den Menschen, mit denen wir in den nächsten 10 Jahren zusammentrafen, keiner, der das Buch kannte. Es war und blieb ein Rätsel – als ob das Buch nie erschienen wäre“ (ebd., 15). Für den Weltärztebund allerdings war die Dokumentation Anlass, die westdeutschen Ärzte wieder in ihren Reihen aufzunehmen, weil Ihr das vorliegende Dokument ausreichend für die Annahme einer Distanz der westdeutschen Ärzte von den Verbrechen während der NS-Herrschaft erschien. In der Bundesrepublik Deutschland aber war eine Chance vertan worden, hatte der Verdrängungsprozess begonnen. Fortan blieb das Thema Medizin und Faschismus tabu oder wurde nur als „schwere Schuld einzelner entarteter Glieder ihres Standes“ dargestellt (ebd., 15).
Als 1976 erstmals Delegierte der „Liste demokratischer Ärzte“ in Hessen zu Landesärztekammerwahlen kandidierten und in der Folge fortschrittliche Listen in zahlreichen anderen Kammerbereichen in die Ärzteparlamente einzogen, zeigte sich, dass die öffentliche Diskussion dieses Themas noch immer auf breitesten Widerstand innerhalb der Standesgremien stieß. In Hessen wurde 1983 der Versuch, im Rahmen der ärztlichen Fortbildung eine Veranstaltung „Medizin ohne Menschlichkeit“ durchzuführen, so umfunktioniert, dass schließlich der § 218 und die Psychiatrie in der Sowjetunion gleichberechtigt neben die Verbrechen der Medizin unter dem Faschismus gestellt wurden. Der Versuch der „Fraktion Gesundheit“ in der Berliner Ärztekammer, die NS-Medizin in Berlin im Rahmen der Kammertätigkeit aufzuarbeiten, war nach heftigen Auseinandersetzungen einer der Gründe für den erzwungenen Rücktritt des von der „Fraktion Gesundheit“ gestellten Vizepräsidenten. Bis heute ist innerhalb der Kammergremien bis hinauf zu dem Deutschen Ärztetag eine offene Diskussion unmöglich, steht die Aufarbeitung dieser auch für die Ärzteschaft so belastenden Epoche noch immer aus.
Schon bald war aus der antifaschistischen Allianz der Siegermächte Feindschaft zwischen Ost und West geworden. Im Ergebnis des kalten Krieges hatte die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und die Eingliederung in das NATO-Militärbündnis stattgefunden. Die Ärzteschaft begleitete diesen Prozess nicht tatenlos. Für die Einbindung der Ärzteschaft in militärische Belange war der Status und die Struktur des Sanitätsdienstes von entscheidender Bedeutung. Während sich der Bundestag noch nicht entschieden hatte, ob die medizinische Versorgung der Soldaten durch einen militärärztlichen Sanitätsdienst oder durch Arzte in Zivil (Kassenärzte) erfolgen sollte, der Bundesrat noch am 8. Februar 1956 die Forderung erhob zu prüfen, „ob und inwieweit der ärztliche Dienst besonderen Sanitätsoffizieren anzuvertrauen sei“, hatten sich führende Ärztevertreter bereits längst für die Eingliederung der Ärzte in die Bundeswehr stark gemacht. Am 11. 4. 1956 folgte dann auch der Verteidigungsausschuss dieser Linie und entschied sich bei den Ärzten für den Status der Sanitätsoffiziere (Berger 1986).
Angesichts des wegen der Vergangenheit belasteten Ansehens der Bundeswehr fehlte es aber an Interessenten. Auch die Gewährung von Studienbeihilfen an die Medizinstudenten, die sich für acht Jahre als Sanitätsoffiziere verpflichteten, und die Genehmigung zur Ausübung einer Nebentätigkeit brachten keine spürbare Besserung des Personalmangels. Im Gegenteil, zahlreiche Studenten waren eher bereit, die Studienbeihilfe zurückzuzahlen, als ihre Verpflichtung gegenüber der Bundeswehr einzugehen. Die entscheidende Wende trat erst ein, als seit dem Wintersemester 1973/74 an die Zentrale Vergabestelle von Studienplätzen der Bundeswehr Studienplätze aus der Quote des „öffentlichen Bedarfs“ zugemessen wurden und den Frauen 1975 die Laufbahn der Sanitätsoffiziere eröffnet wurde (Berger 1986). Ohne eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Standesorganisationen mit dem Verteidigungsministerium und der Bundeswehr, wie sie sich formal in dem 1963 konstituierten wehrmedizinischen Beirat niederschlug, wäre diese Entwicklung undenkbar gewesen oder zumindest erschwert worden.
Das Verhältnis zur Bundeswehr, zur Militärdoktrin der NATO, die beabsichtigte Rolle der Ärzteschaft in einem möglichen, mit konventionellen, atomaren, biologischen und chemischen Waffen geführten Krieg erforderten schon bald darüber hinaus Stellungnahmen der Ärzteschaft. Dabei zeigten sich erneut die verhängnisvollen Auswirkungen der vielfach ungebrochenen personellen und ideologischen Tradition.[1] Schon 1946 hatten sich die Landesärztekammern zu einer „Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Landesärztekammern“ auf Bundesebene zusammengeschlossen. Dieses Gremium ohne staatliche Aufgaben, ohne staatliche Rechtsgrundlagen bzw. verfassungsmäßigen Auftrag stellt de facto eine Nachfolge der 1945 aufgelösten Reichsärztekammer dar. Politisch bedeutungsvolle Entscheidungen werden nicht in den Landesärztekammern, sondern in der Bundesärztekammer und ihren Gremien, besonders den jährlich einmal stattfindenden „Deutschen Ärztetagen“, getroffen. Diese Beschlüsse geben in besonderem Maße die Einstellung der ärztlichen Standesführung wieder. Zur Problematik Krieg und Ärzteschaft bemerkte der Vorstand der Bundesärztekammer am 17. Juni 1983: „Seit über einem Vierteljahrhundert warnt der Vorstand der Bundesärztekammer vor den Gefahren der Waffenanwendung, insbesondere von Massenvernichtungswaffen. Die deutschen Ärztetage bekundeten ihre Auffassung, dass die deutschen Ärzte in besonderem Maße und wegen ihrer Kenntnisse der jüngeren Geschichte gegen jede Art kriegerischer Auseinandersetzungen sind. Sie verurteilen jede Form der Waffen und Gewaltanwendung als Mittel der Machtexpansion…“1. Tatsächlich war der Beschluss des 61. Deutschen Ärztetages 1958: „Warnung der Verantwortlichen in der ganzen Welt vor dem frevlerischen Missbrauch der Atomenergie“ und die Forderung nach „Achtung aller Massenvernichtungswaffen“ sowie der „Verzicht auf weitere Atomwaffenversuche“ bis 1982 allerdings der einzige Beschluss, der sich gegen die Atomkriegsgefahr wandte. Wie eine Aufstellung im Münchner Ärztlichen Anzeiger vom 22. Dezember 1984 zeigt, haben alle übrigen Aktivitäten der Bundesärztekammer in unterschiedlicher Weise die Vorbereitung der Ärzteschaft und des Gesundheitswesens auf den Kriegsfall und nicht die Verhütung desselben zum Thema:
Dokumentation
Über die Aktivitäten der Bundesärztekammer zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall
1958
Beschluss des 61. Deutschen Ärztetages in Garmisch-Partenkirchen „Atomgefahren“
1969
Entschließung des 72. Deutschen Ärztetages 1969 in Hannover über die Sicherung der ärztliche Versorgung im Katastrophenfall
1971
Entschließung des 74. Deutschen Ärztetages 1971 in Mainz über die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Katastrophen- und Verteidigungsfall
1976
Entschließung des 79. Deutschen Ärztetages 1976 in Düsseldorf über die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Katastrophenfall
1978
Entschließung des 81. Deutschen Ärztetages 1978 in Köln über die Verabschiedung eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes
seit 1978
Behandlung der Katastrophenmedizin und der medizinischen Versorgung im Zivilschutz auf allen Internationalen Fortbildungskongressen der Bundesärztekammer
1979
Entschließung des 82. Deutschen Ärztetages 1979 in Nürnberg über die Verabschiedung eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes
1979
Konstituierende Sitzung des Arbeitskreises „Ärztliche Hilfe bei Katastrophen“ des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer
1980
Entschließung des 83. Deutschen Ärztetages 1980 in Berlin über die Versorgung der Bevölkerung im Katastrophen- und Verteidigungsfall
1980
Entschließung des 83. Deutschen Ärztetages 1980 in Berlin über das Gesundheitssicherstellungsgesetz – Rettungswesen
1980
„Katastrophenmedizin und medizinische Versorgung im Zivilschutz (einschließlich Kernkraftkatastrophen)“ als Thema des IV. Interdisziplinären Forums der Bundesärztekammer in Köln unter Beteiligung namhafter internationaler Experten
1980
„Ärztliche Hilfe bei Katastrophen“, Pressekonferenz der Bundesärztekammer in Bonn
1982
Entschließungen des 85. Deutschen Ärztetages in Münster
– Warnung vor den Gefahren des Krieges
– Ärztliche Hilfe im Katastrophen- und Verteidigungsfall
1983
Beschlüsse des Vorstandes der Bundesärztekammer
– Indikationsstufen ärztlichen Einsatzes in Katastrophenfällen
– Warnung vor den Gefahren des Krieges – Katastrophenmedizinische Präventiv-Maßnahmen.
„Niemand kann der atomaren, chemischen und bakteriologischen Kriegsdrohung der Gegenwart gleichgültig gegenüberstehen, sie bedroht die ganze Menschheit.
Als Ärzte warnen wir alle verantwortlich denkenden und handelnden Bürger vor der sich anbahnenden Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Die Aufgabe aller Bürger ist es, jedem Krieg entgegenzuwirken, denn jeder Konflikt kann zur nuklearen Katastrophe eskalieren. Im Sinne einer langfristigen, konsequenten Friedenspolitik ist es erforderlich, dass
- bei den Völkern in Ost und West Feindbilder abgebaut werden und wechselseitiges Vertrauen aufgebaut wird,
- die Bevölkerung über die Folgen und Wirkungen insbesondere der atomaren, chemischen und bakteriologischen Massenvernichtungsmittel rückhaltlos aufgeklärt wird,
- keine weiteren Massenvernichtungsmittel entwickelt und die vorhandenen Bestände in allen Teilen der Welt kontrolliert und abgebaut werden.“
Unter dem Druck der Friedensbewegung innerhalb der Ärzteschaft zustande gekommene Entschließung des 85. Deutschen Ärztetages in; Münster vom 13. Mai 1982.
Aber selbst die beiden Beschlüsse von 1958 und 1982 wären ohne eine Veränderung im außerhalb der Bundesärztekammer gelegenen politischen Rahmen nicht zustande gekommen. 1955 hatte der Arzt Albert Schweitzer wiederholt weltweit zur Ächtung der Atomwaffen aufgerufen. 1956 wurde von deutschen Ärzten der „Kampfbund gegen Atomschäden“ gegründet. 1957 hatte sich eine „Ärztegesellschaft zur Ächtung des Atomkrieges“ gebildet. Auf den Ärztetagen 1956 und 1957 wurden wiederholt Anträge gegen die Atomkriegsgefahr erfolglos eingebracht. Als schließlich nahezu 1000 Hamburger Ärzte in einer Zeitungsanzeige an die Landesärztekammer und den Deutschen Ärztetag appellierten, die Atomkriegsgefahr zu bannen, und sich immer mehr Arzte diesem Aufruf anschlossen, rang sich auch der 61. Deutsche Ärztetag zu einem entsprechenden Beschluss durch (Hövener 1985; Jogschies 1986). Auch der zweite gegen die drohende Atomkriegsgefahr gerichtete Beschluss von 1982 auf dem Ärztetag in Münster stand am Ende einer außerhalb der Ärzteschaft in Gang gesetzten und sehr erfolgreichen Mobilisierungskampagne. Nach dem Nato-Doppelbeschluss 1979 und der begonnenen Stationierung von zielgenauen Mittelstreckenraketen auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland hatten sich Millionen Menschen für die Friedensbewegung engagiert, war diese auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung angelangt. 1981 hatte der „Erste Medizinische Kongress zur Verhinderung eines Atomkrieges“ stattgefunden. Über l 500 Teilnehmer wurden gezählt. So konnte auch der Ärztetag 1982 gegen den erklärten Willen des Präsidiums den oben angeführten Beschluss nicht verhindern. Eine Umsetzung der Beschlüsse in politische Aktivitäten fand allerdings weder 1958 noch 1982 statt. Vielmehr konzentrierte sich die Standesführung auf konkrete Aufgaben im Zusammenhang mit einem seit Jahren geforderten Zivilschutzgesetz. Dieses Thema wurde für die kommenden Jahre und ist heute noch der Kristallisationspunkt ärztlicher Einstellung zu Krieg und Frieden. An den Vorbereitungen des Gesundheitswesens auf den Verteidigungsfall durch ein bis heute noch nicht verabschiedetes Zivilschutzgesetz sollte die Ärzteschaft in zwei sich unversöhnlich gegenüberstehende Lager gespalten werden. Ein Konflikt, der an Schärfe im Laufe der Jahre eher noch zugenommen hat. Vorausgegangen war eine der Basis der Ärzteschaft weitgehend verborgen gebliebene Entwicklung innerhalb ihrer Standesführung.
Seit Gründung der Bundeswehr wurden zahlreiche Gremien installiert, die sich mit Zivilverteidigungsaufgaben bzw. Zivilschutz befassen. Seit 1957 wirkt die Bundesärztekammer nach eigenen Angaben offiziell an der Gestaltung des Sanitätswesens der Bundeswehr und bei der Entwicklung des Zivilschutzes mit. 1955, noch vor Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, wurde der „Ausschuss für den Sanitätsdienst der Bundeswehr und des Zivilschutzes“ gebildet (1984 umbenannt in „Ausschuss und ständige Konferenz Sanitätswesen im Katastrophen-, Zivilschutz und in der Bundeswehr“). Der Chef des Sanitätswesens der Bundeswehr ist Mitglied des Präsidiums des „Deutschen Ärztetages“. Die Inspektion des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr koordiniert die Aus- und Fortbildung der Sanitätsoffiziere, die kriegsmedizinische Forschung sowie die Einbeziehung ziviler Institutionen. Beim Innenministerium wurde eine Abteilung Zivilverteidigung im Zivilschutz mit den nachgeordneten Einrichtungen Bundesamt für Zivilschutz, Akademie für zivile Verteidigung und Bundesverband für den Selbstschutz eingerichtet. Das Innenministerium ist auch gemeinsam mit dem Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit für die Einbeziehung des Gesundheitswesens und der Ärzteschaft in die verteidigungspolitische Planung verantwortlich. Spezielle Stäbe mit Ausschüssen für die Sicherstellung der militärisch-zivilen Zusammenarbeit existieren auf allen staatlichen Ebenen. Vereinbarungen über den Umfang der für den Kriegsfall mobil zu machenden Arzte wurden zwischen dem Ministerium der Verteidigung und dem Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit geschlossen (Richter 1984).
Im August 1963 konstituierte sich der „wissenschaftliche Beirat für das Sanitäts- und Gesundheitswesen beim Bundesminister der Verteidigung“ (wehrmedizinischer Beirat), dem 40 Professoren der Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Lebensmittelchemie und der Psychologie angehören. Besonders Arbeitsmediziner beraten hier den Verteidigungsminister, tragen zur Effizienz militärischer Tauglichkeit der Soldaten bei, aber auch die zivile militärische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arzneimittelversorgung wird hier intensiviert.
Sichtung
„Neben den akut lebensbedrohten, jedoch nach kurzem, rettendem Eingriff bald transportfähigen Patienten stellen die Schwerstgeschädigten den Arzt vor die schwierigste Aufgabe. Er sieht sich Menschen gegenüber, die vielfache oder schwerste Schädigungen ihrer Gesundheit erlitten haben oder nur noch schwache Lebenszeichen erkennen lassen und nach menschlichem Ermessen in Kürze sterben werden. Es ist jedem Arzt eine ethische Selbstverständlichkeit, dass er an einem offensichtlich sterbenden Menschen keine unsinnigen Therapieversuche vornimmt (…).
Stets muss der Arzt dafür sorgen, dass alle Schwerstverletzten unter ständiger Beobachtung durch erfahrene Mitarbeiter bleiben, um jede Besserung oder Verschlechterung des Zustandes sofort zu erfassen, in manchen Fällen werden sich Atmung, Herz- und Kreislauffunktion erholen oder ein Schock lösen, wenn zusätzliche Belastungen durch intensivere Behandlungs- oder Untersuchungsmaßnahmen und vorzeitiger Abtransport trotz fehlender Transportfähigkeit vermieden werden.
Schwerstgeschädigte sind zunächst Schon- und Beobachtungsfälle. Behandlung und Abtransport erfordern stets äußerste Sorgfalt und erheblichen Aufwand durch Erfahrene. Schwerstbetroffene und selbst Menschen, deren Leben zu erlöschen scheint, sind keineswegs „Ausgesonderte“ oder durch ärztliche Willkür „zum Tode Verurteilte“.
(Rebentisch, E.; Sichtung- eine zwingende ärztliche Aufgabe beim Massenanfall. Deutsches Ärzteblatt 83, 1986, S. 389.)
Die enge Verbindung zwischen Bundeswehr und ärztlichen Standesorganen spiegelt sich exemplarisch in der Person des Generaloberstabsarztes Prof. Dr. med. E. Rebentisch wider. Wenn es in einer Laudatio auf diesen Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens in den Jahren von 1976 bis 1980 heißt: „Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgte er die Verbesserung der zivilen-militärischen Zusammenarbeit, wobei er ganz besonders immer wieder die Notwendigkeit eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes betonte“, so ist damit seine gleichzeitige Zugehörigkeit zum Präsidium des Deutschen Ärztetages und der Bundesärztekammer als Mitglied des Arbeitsausschusses für Katastrophenmedizin angesprochen (Krawiez 1980, 65). Ebenso aufschlussreich und beispielhaft für die militärisch-medizinische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 ist der Lebensweg dieses Mannes. „Nach dem Abitur in Darmstadt und Ableistung der Arbeitsdienstpflicht begann der gebürtige Offenbacher seine Laufbahn als Berufsoffizier im November 1937 als Fahnenjunker in der Panzer-Abwehr-Abteilung 23 in Potsdam. Den Polenfeldzug erlebte er als Leutnant und wechselte 1941 zur Panzertruppe, bei der er als Kompaniechef und später als Abteilungskommandeur und Regimentsführer über den gesamten Russlandfeldzug, im wesentlichen im Südabschnitt, verblieb. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kreuz in Gold, dem Panzerkampfabzeichen in Silber, anderen hohen Auszeichnungen und zweimaliger Nennung im Wehrmachtsbericht geriet Major Rebentisch 1945 in amerikanische Gefangenschaft. Seine frühzeitige Entlassung ermöglichte es ihm, bereits 1945 das Studium der Medizin zu beginnen. Nach Approbation und Promotion befand er sich als Assistenzarzt von 1950-1958 am Stadtkrankenhaus in Offenbach, wo er 1958 seine Anerkennung als Facharzt für Chirurgie erhielt. Nach einer Tätigkeit als chirurgischer Oberarzt im Kreiskrankenhaus Gelnhausen wurde er 1959 wieder Soldat. Beginnend als Oberstabsarzt und leitender Sanitätsoffizier beim DBvBer AFNORTH wurde er bis zu seiner Beförderung zum Generaloberstabsarzt und Ernennung zum Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens im Oktober 1976 in verschiedenen führenden Dienstposten eingesetzt. Als Referent im Bundesministerium der Verteidigung, als Divisionsarzt der 12. Panzerdivision und Kommandeur des Sanitätsbataillons 12 sowie als Kommandeur der Akademie des Sanitäts- und Gesundheitswesens konnte er in wesentlichen Bereichen seine Kenntnisse in Medizin und Führung zum Wohle des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, aber auch darüber hinaus verwenden. 1972 leitete er den Einsatz des Sanitätsdienstes bei den Olympischen Spielen. 1975 erfolgte die Berufung zum Honorarprofessor für Katastrophen- und Wehrmedizin der TU München. Als Stellvertreter des Inspekteurs und ab 1976 als Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens setzte Professor Rebentisch wesentliche Schwerpunkte im Sanitätsdienst der Bundeswehr“ (Krawiez 1980, 65).
Als jüngste Beispiele für die Personalunion von Standesfunktionen und militärischen Dienstgraden sei auf die Übernahme der Leitung der Pressestelle der deutschen Ärzteschaft durch den vorzeitig pensionierten Major der 5. Panzerdivision K. H. Strelow am l. Januar 1986 und die Wahl des Reserveoffiziers Dr. med. Popovic zum geschäftsführenden Arzt der Landesärztekammer Hessen im Sommer 1986 hingewiesen.
Die militärische Verplanung der ärztlichen Basis hatte über all die Jahre hinweg längst von dieser unbemerkt stattgefunden. Es war einem Zufall zu verdanken, dass die Delegierten der Liste demokratischer Arzte in der Landesärztekammer Hessen 1984 die seit Jahren praktizierte Weitergabe von Daten hessischer Ärzte durch die Landesärztekammer Hessen an die Wehrbereichsbehörden entdeckten und die Öffentlichkeit darüber informierten. Erst nach der Sammlung von Unterschriften, einem Go-in beim Präsidium der Landesärztekammer Hessen und der Einschaltung des hessischen Datenschutzbeauftragten wurde diese Praxis beendet.
Die Liste demokratischer Ärzte in der Ärztekammer Westfalen-Lippe deckte im Juni 1986 einen ähnlichen Fall auf. Die Ärztekammer hatte Namen, Anschriften und Gebietsbezeichnungen von niedergelassenen Ärzten an das Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen weitergeleitet. Dieses wiederum teilte die Ärzte an Hand der gelieferten Daten in fünf verschiedene vorgesehene Tätigkeiten für den Fall eines „Massenanfalls von Verletzten“ ein. Wie in Hessen bewirkte erst die Einschaltung des zuständigen Datenschutzbeauftragten eine Änderung der gesetzwidrigen Weitergabe von Daten durch die Landesärztekammer.
Jahrelang hatten ärztliche Gremien vergeblich ein Zivilschutzgesetz gefordert. 1980 wurde der Öffentlichkeit eine populär gehaltene und für die Auslage im Wartezimmer geeignete Fassung der „Gesundheits- und sozialpolitischen Vorstellungen der deutschen Ärzteschaft – das Ärzteprogramm für dieses Jahrzehnt“ (1980) vorgelegt. Während man vergeblich nach einer Warnung vor den Atomkriegsfolgen oder wenigstens einem Hinweis auf diesbezügliche Beschlüsse nationaler und internationaler wissenschaftlicher Einrichtungen sucht, nimmt der Abschnitt „Katastrophenschutz“ breiten Raum ein. Wegen der für die spätere Argumentationsweise typischen Subsumierung kriegerischer Ereignisse unter den Begriff der Katastrophe und der für heutige Verhältnisse ungeschminkten Darstellung der Position der Ärzteschaft hat dieses Papier einen besonderen Stellenwert. Im Frage-Antwort-Stil zwischen Patient und Arzt heißt es hier unter anderem:
„Herr Doktor, wenn morgen eine Katastrophe über uns hereinbricht, sei es eine Überschwemmung oder eine andere Naturkatastrophe, ist dann die medizinische Versorgung der Bevölkerung noch sichergestellt?
Nach Verabschiedung der Notstandsgesetze vor über zehn Jahren sind die dringend erforderlichen gesetzlichen Regelungen zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung immer noch nicht in die Tat umgesetzt. Auch die großen Katastrophen der letzten Jahre wie regionale Grenzen überschreitende Waldbrände, Überschwemmungen und Schneeverwehungen haben den Gesetzgeber noch immer nicht dazu veranlasst, für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in Katastrophen- und Notzeiten eine ausreichende gesetzliche Grundlage zu schaffen.
Die Bevölkerung macht sich noch wenig Gedanken um eine Versorgung in Notzeiten. Sie denkt nicht daran und fühlt sich sicher und geborgen. Müssen wir alle umdenken?
Eines ist dringend geboten: In der Öffentlichkeit muss das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass Zivilschutz eine lebensnotwendige Ergänzung unserer Gesundheitspolitik und Verteidigungsbereitschaft ist. Dies ist nur mit einer breit angelegten Aufklärungsaktion möglich.
Was kann denn der einzelne für seinen ganz persönlichen Schutz tun?
Dazu gehört zum Beispiel, dass man immer ein paar Lebensmittel und Medikamente als eiserne Vorratsreserve aufbewahrt, dass Werkzeuge griffbereit stehen, um Brände löschen oder Trümmer beseitigen zu können. So wie jeder Führerscheinbewerber einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss, sollten auch Nicht-Autofahrer in den wichtigen Fertigkeiten Erster Hilfe ausgebildet werden.
Gibt es überhaupt genügend Helfer, die bei einer Katastrophe freiwillig antreten, um mit anzupacken?
Das ist wohl das größte Problem. Die freiwillige Mitarbeit im Zivilschutz muss verstärkt werden, aber sie reicht dennoch nicht aus. Wie im Ausland ist auch bei uns eine generelle Verpflichtung zur Teilnahme am Zivilschutz notwendig. Im Blauen Papier heißt es: ‚Darüber hinaus muss die schon jetzt für Ärzte und medizinisches Fach- und Pflegepersonal für den Verteidigungsfall bestehende Dienstpflicht zu einer generellen Verpflichtung im Rahmen des Zivilschutzes erweitert werden.'“
Im Januar 1984 war es dann soweit. Der Bundesärztekammer wurde offiziell der „Vorläufige Referentenentwurf eines Zivilschutzgesetzes“ zur Stellungnahme zugeleitet. „Von der Bundesärztekammer wird die Zielsetzung und der grundsätzliche Aufbau des vorläufigen Referentenentwurfs begrüßt, da er auch im Verteidigungsfall an dem bestehenden differenzierten Versorgungssystem festhält“2. Die Stellungnahme gipfelt in der Forderung nach Pflichtfortbildung in Katastrophenmedizin, also Medizin für den Kriegsfall: „Eine Verpflichtung zur Fortbildung in Notfallmedizin ergibt sich aus § 20,4 der Musterberufsordnung für die deutschen Ärzte. Darüber hinaus hat sich jeder Arzt, basierend auf der Generalpflichtenklausel und dem § 7 der Musterberufsordnung, in Katastrophenmedizin fortzubilden, da er im Ausnahmezustand einer Katastrophe zur Hilfeleistung in der Lage sein muss“. Diese Forderung ist insofern eine Abkehr von bisherigen Positionen, als die Fort- und Weiterbildung seit jeher auf freiwilliger Basis stattfand und alle Tendenzen zur Einschränkung dieser Freiwilligkeit von den Standesvertretungen aufs schärfste bekämpft wurden.
Gegen diese Politik der Standesführung hatte sich ein wachsender Widerstand innerhalb der Ärzteschaft herangebildet. Die IPPNW hatten mehrere tausend Mitglieder in ihrer bundesdeutschen Sektion gewinnen können. Mehr als 100 Friedensinitiativen im Gesundheitswesen waren nach dem Nato-Doppelbeschluss entstanden. In mittlerweile mehr als 10 Landesärztekammern waren Delegierte fortschrittlicher Listen mit einem Stimmenanteil von 10 bis 20% eingezogen. Gegen diese Entwicklung entfaltete die Standesführung im „Deutschen Ärzteblatt“ eine Kampagne, die mit einem Kommentar des damaligen Geschäftsführers Volrad Deneke am 1. Oktober 1981 wie folgt eingeleitet wurde: „Ein Angriff auf die sittliche Substanz des Arzttums“ als Reaktion auf den l. Medizinischen Kongress zur Verhinderung eines Atomkrieges in Hamburg. Die Ärzte aus der Friedensbewegung wurden darin als „offenkundige Propagandisten zugunsten des sowjetischen Imperialismus“ bezeichnet, die an der „ethischen Tarnkappe materialistischer Machtpolitiker stricken“. Die Schlagzeile „Ärzte warnen vor dem Knollenblätterpilz“ habe die „gleiche ethische Dimension wie die Parole Ärzte warnen vor dem Atomtod“. Es handele sich um „zutiefst unmoralische, unärztliche und unmenschliche Verweigerung ärztlicher Hilfeleistung“ (Deneke 1981, 1856). Nach diesem Frontalangriff und der so nicht erwarteten Reaktion (mehr als 300 Leserbriefe erreichten das Deutsche Ärzteblatt) wurden die Töne moderater. Die Einheit der Ärzteschaft, Haupttrumpf bei der Durchsetzung standespolitischer Forderungen, war in Gefahr. Nun wurden auch Leserbriefe von Ärzten aus der Friedensbewegung veröffentlicht, eine Stellungnahme der IPPNW abgedruckt, Auszüge aus der WHO-Studie über die „Auswirkungen eines Atomkrieges auf die Gesundheit und des Gesundheitswesens“ wurden kommentiert (Popovic 1985). Dem Kommentator, dem Reserveoffizier der Bundeswehr, M. Popovic, gelang das Kunststück, die entscheidende Folgerung dieser Studie: „Die einzige Möglichkeit, die gesundheitlichen Folgen einer atomaren Explosion zu bewältigen, besteht in der Verhinderung solcher Explosionen und also in der Verhinderung eines Atomkrieges“ in die angebliche Forderung der WHO nach Katastrophenmedizin und kriegsmedizinischer Selektion (Triage) umzuwandeln. Immerhin war an die Stelle der Verleumdung die offensive Auseinandersetzung getreten.
Anlässlich des vom 29. Mai bis 1. Juni 1986 in Köln tagenden Weltkongresses der IPPNW kam es zu einer neuerlichen Zunahme der Angriffe der Standesorgane, voran des „Deutschen Ärzteblattes“, auf die in der Friedensbewegung engagierten Ärzte. Die Auseinandersetzung gipfelte im Boykott des Kongresses durch die Bundesärztekammer unter dem Vorwand, der Kongress diene in erster Linie allgemeinpolitischen Auseinandersetzungen und diese seien wiederum keine standespolitische Aufgabe3. Allerdings hatte dieser einmalige Vorgang – die vorangegangenen IPPNW-Weltkongresse waren ausnahmslos mit Unterstützung der jeweils nationalen ärztlichen Standesorganisationen veranstaltet worden – tiefe Risse in der bundesdeutschen Ärzteschaft hinterlassen. Die Hauptversammlung des Marburger Bundes hatte entgegen dem Vorschlag seines Vorstandes eine Teilnahme durch einen offiziellen Vertreter verlangt. Unter Missachtung dieses Beschlusses schloss sich dennoch der Marburger Bund dem Boykott durch die Bundesärztekammer an, und nur der Vorsitzende des Verbandes der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, Erwin Hirschmann, und der Präsident der Ärztekammer Nord-Württemberg, Peter Boeckh, fanden den Mut, sich dieser Vorgehensweise zu widersetzen.
Auf dem 89. Deutschen Ärztetag in Hannover vom 29. April bis 3. Mai 1986 waren die Auswirkungen der Auseinandersetzung mit der IPPNW deutlich zu spüren. Die Atomkriegsproblematik ließ sich nicht ausklammern, und es mussten Zugeständnisse an die Kritiker der Vorstandslinie gemacht werden. Mit knapper Mehrheit wurde ein Beschluss für ein Atomteststoppabkommen – eine der Hauptforderungen der IPPNW – gefasst und die WHO-Studie über die „Auswirkungen eines Atomkrieges auf die Gesundheit und das Gesundheitswesen“ ausdrücklich unterstützt, allerdings wurden gleichzeitig katastrophenmedizinische Fortbildung und organisatorische Vorbereitungen gefordert4.
Bei der Bewertung der Beschlüsse Deutscher Ärztetage muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese keineswegs ein getreues Abbild der ärztlichen Basis darstellen. Bis heute werden Delegierte der „Listen demokratischer Ärzte“ in einigen Kammerbezirken von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Aktivitäten für eine Vorbereitung des Gesundheitswesens auf den Kriegsfall, die Einbindung der Ärzteschaft in die NATO-Strategie beschränken sich aber nicht auf die Bundesärztekammer. Die zahlreichen Zweck- und Fachverbände, untereinander durch Verträge über Zusammenarbeit, Konsultationsringe, die Mitgliedschaft in der 1978 gegründeten „Bundesvereinigung deutscher Ärzteverbände e. V.“ sowie durch Doppelmitgliedschaft bzw. Personalunion leitender Funktionäre verbunden, haben mehr oder weniger erfolgreich „Basisarbeit“ unter ihren Mitgliedern in Sachen Zivilschutz geleistet. Die scheinbare Pluralität tritt hinter dem gemeinsamen Bekenntnis zur Notwendigkeit angeblicher Gesundheitssicherstellungsmaßnahmen für den Kriegsfall zurück. Allen voran der ursprünglich als Dachverband geplante „Hartmann-Bund – Verband der Ärzte Deutschlands“. Erste Zusammenkünfte zwischen aktiven Sanitätsoffizieren der noch im Aufbau befindlichen Bundeswehr und ehemaligen Sanitätsoffizieren der Naziwehrmacht wurden vielerorts vom 1949 neu gegründeten Hartmann-Bund organisiert. Gebetsmühlenhaft wiederholt er Jahr für Jahr seine 1978 aufgestellte Forderung nach einem Zivilschutzgesetz. Die Karriere des Wortführers dieser Kampagne, der stellvertretende Vorsitzende des Hartmann-Bund-Arbeitskreises „Arzte in der Bundeswehr und im Zivilschutz“, Generalarzt a. D. Dr. med. Kurt Gröschl, ist dabei beispielhaft für ehemalige Sanitätsoffiziere der Hitlerwehrmacht. Von 1933 bis 1945 tat er seinen Dienst als Sanitätsoffizier in der Deutschen Wehrmacht, von 1945 bis 1956 arbeitete er als praktischer Arzt und Multifunktionär im Hartmann-Bund und der Kassenärztlichen Vereinigung. Von 1956 bis 1968 war er tätig als Wehrbereichsarzt und Kommandeur der Akademie für Sanitäts- und Gesundheitswesen der Bundeswehr. Von 1968 bis 1976 war er Mitglied der wehrmedizinischen Gesellschaft mit Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Wehrmedizin. Darunter folgende Titel: „Wann kommt das Gesundheitssicherstellungsgesetz – notwendige Ergänzung der Gesundheitspolitik; Gesundheitssicherstellungsgesetz schnellstens realisieren usw.“ (Gröschl 1980).
Während sich der Hartmann-Bund lediglich einen wehrmedizinischen Arbeitskreis leistet, um seinen Vertretungsanspruch für alle Ärzte nicht zu gefährden, kümmert sich ein anderer Verband nicht im geringsten um derartige taktische Erwägungen. Gemeint ist die bereits im Juni 1954 gegründete und als Kameradschafts- und Traditionsverband getarnte „Vereinigung ehemaliger Sanitätsoffiziere“, die sich am 16. Januar 1968 dann den weniger auf die belastende Tradition verweisenden Namen „Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie e. V.“ gab. Dieser Verein garantierte die Mitarbeit ehemaliger Berufs- und Reserveoffiziere des Sanitätsdienstes der Naziwehrmacht bei der Remilitarisierung der Bundesrepublik. Das Organ dieses Verbandes, die erstmals 1956 erschienene „Wehrmedizinische Monatsschrift“, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister der Verteidigung, ist Ausdruck eines ungebrochenen militärischen Traditionsverständnisses. Weder der Erste Weltkrieg noch die deutsche Hitlerwehrmacht werden kritisch betrachtet. In einer Würdigung des verstorbenen Generalarztes a. D. Dr. Grüne am 12. Februar 1986 heißt es: „Den Träger des Deutschen Kreuzes in Gold, des EK I und II Pz Nahkampfabzeichens in Bronze und des Erdkampfabzeichens zeichneten soldatischer Mut, hohes Pflichtgefühl und prägende Führungskunst aus“5. Aber auch aktuelle Probleme des Sanitätsdienstes werden erörtert, unter der Überschrift „Das Berufsbild des Sanitätsoffiziers heute“ heißt es unter anderem: „Wenn es den Ärzten nicht zur Auflage gemacht wird, regelmäßig an militärisch-taktischen Übungen und Manövern – natürlich in entsprechender Funktion -teilzunehmen, so wird ihr Wissen um die militärischen Erfordernisse gänzlich verloren gehen, und sie sind von zivilen Ärzten überhaupt nicht mehr zu unterscheiden“ (Grunewald 1986, 270). Und da es offenbaren Menschen wie den Generalarzt a. D. Dr. Grüne heutzutage fehlt, beschäftigt man sich mit Überlegungen, wie diesem Missstand abgeholfen werden kann unter der Überschrift: „Leistungseinschränkung und Krankheit durch falsche Leitbilder: …So könnten sich im Rahmen der präventiven Arbeit Risikogruppen erstellen lassen, die unter Belastung bevorzugt den Anforderungen nicht mehr gewachsen sein werden. Durch geeignete Interventionsverfahren könnten sich dort Risikopotentiale abbauen lassen“ (Meyer, Furtwängler & Kindermann 1986, 229).
Bei der Lektüre des Programms der Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahre 1981 in Oldenburg vom 17. bis 21. Juni 1981 fühlt man sich in eine vergangen geglaubte Welt versetzt:
- „Anzugsordnung: Für die Teilnehmer an der Veranstaltung ist das Tragen der Uniform erwünscht.“
- „Das Hilfspersonal, Feldjäger und Bedienungspersonal sind angewiesen,
- ohne Berechtigungskarten den Zutritt zu verwehren bzw. nichts auszuhändigen.“
- „Flottenarzt Prof. Dr. Sturde spricht zum Thema: Geschlechtskrankheiten bei den Soldaten im Wandel der Zeiten.“
- „Oberstarzt d. R. Prof. Dr. Dr. H. Görke referiert zum Thema: Katastrophen, die die Welt veränderten.“
Es werden Verladeübungen von Verletzten durchgeführt, und anschließend referiert Prof. Dr. Sticki über „Die Unsicherheit als Faktor des täglichen Lebens“ (dieser Vortrag erschien der Redaktion des Deutschen Ärzteblattes so grundlegend, dass sie ihn in voller Länge abdruckte). Und nachdem sich die Tagungsteilnehmer drei Tage lang mit Katastrophen durch Strahlen, chemische Gifte, der Erkennung und Isolierung von Panikpersonen und vielem mehr befasst hatte, konnten sie sich dann am Abend im „Rahmen- und Damenprogramm“ im Offiziersheim des Fliegerhorstes Oldenburg bei Aalessen nach Ammerländer Art beim Klang der Tanzgruppe des Vereins für Heimatpflege „entspannen“. Für die weniger katastrophenmedizinisch interessierten Damen gab es noch ein Damenkosmetikprogramm: „Das aktuelle Abend-make up“. Und als Zeichen für das Eingebundensein der Veranstaltung in bundesrepublikanische Realität, für die vielfältige und gegenseitig nutzbringende Beziehung zur Pharma- und medizinischen Geräteindustrie bedankte sich die Bundesgeschäftsstelle der Gesellschaft bei 66 (!) alphabetisch aufgeführten Firmen, mit deren „nicht nur finanziellen wertvollen Unterstützung es möglich war, die Tagung vielseitig und abwechslungsreich zu gestalten“.
Nicht weniger bemüht in Sachen Vorbereitung auf den Ernstfall ist die 1980 gegründete „Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin“. Sie ist Teil der zahlreichen Aktivitäten in der Ärzteschaft nach dem Nato-Doppelbeschluss mit dem Ziel, die Forderung nach Verankerung der Medizin im sogenannten Massenanfall von Verletzten endlich in die Tat umzusetzen. Während bei der „Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie“ der militärische Charakter offen zu Tage tritt, gibt sich die „Gesellschaft für Katastrophenmedizin“ als Fachverband wissenschaftlich unpolitisch. Bei der ersten Tagung in München am 1. und 2. Juli 1982 wurde den Besuchern allerdings schnell klar, dass militärisches Denken ganz wesentlich die Inhalte bestimmte. Ein Drittel der Anwesenden bestand aus uniformierten Ärzten aller Waffengattungen. Ohne Umschweife sprach man vom Verteidigungsfall, wurde die mittlerweile von der sozialliberalen Regierung vorgenommene Rücknahme des Gesundheitssicherstellungsgesetzentwurfes bedauert, zeigte sich der Vertreter des Bundesamtes für Zivilschutz, P. W. Kolbe, erfreut, dass „schon vor Afghanistan ein zunehmendes Interesse am Schutzraumbau“ zu bemerken gewesen sei. Selbstverständlich wurde die militärische Sichtung (Triage) geübt und erläutert. Und der katholische Moraltheologe aus Bonn, F. Böckle, gab dem Ganzen mit seinem Vortrag „Ethik ärztlichen Handelns in der Katastrophe“ seinen Segen (Theml & Schramm 1982).
Angesichts der unerwartet heftigen Kritik der Öffentlichkeit an der offenkundig kriegsmedizinischen Ausrichtung der Tagung vermied man bei den folgenden Kongressen der Gesellschaft peinlich Themen mit eindeutig kriegsmedizinischer Tendenz, ohne das Hauptziel der Gesellschaft, die zunehmende Durchdringung medizinischer Aus-, Fort- und Weiterbildung mit katastrophen- und kriegsmedizinischen Inhalten, aus den Augen zu verlieren.
Ganz anders verhält sich der mitgliederstärkste Ärzteverband, der „Marburger Bund – Verband der angestellten und beamteten Ärzte e. V.“. Diese Standesvereinigung wurde 1948 als Reaktion auf die sich angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Lage zunehmend in der „Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr“ organisierenden Ärzte in Marburg gegründet. In Kenntnis der weitverbreiteten Ablehnung eines Zivilschutzgesetzes mit den entsprechenden Auswirkungen schon in Friedenszeiten wie Registrierung, Zwangsfortbildung in Triage etc. durch die Mitglieder vermeidet die CDU-nahe Führung – der Bundesvorsitzende Dr. J. Hoppe ist Mitglied im gesundheitspolitischen Ausschuss der CDU – jegliche positive Stellungnahme zum Zivilschutzgesetz. Auf dem Höhepunkt der Diskussion 1982 fanden die Mitglieder im Editorial der Februar-Nummer ihrer Zeitschrift „Der Arzt im Krankenhaus“ unter der Überschrift „Sicherstellung“ die Forderung nach deutlicher Trennung von Katastrophenfall und Verteidigungsfall. Weiter heißt es: „Gerade weil die Ärzte, die er (der Marburger Bund) vertritt, sich ihrer Verantwortung gegenüber den Opfern von Ausnahmezuständen aller Art bewusst sind, verlangt er für den Extrem-Einsatzbereich größtmögliche Klarheit. Mit den Arztkollegen in aller Welt hält er es aber auch für notwendig, den Politikern immer wieder einzuschärfen, dass der Krieg verabscheuungswürdig und als Mittel der politischen Auseinandersetzung auszuschließen ist und dass es im äußersten Fall für nichts und niemand irgend eine Sicherstellung geben kann“6. Der Marburger Bund bleibt die Antwort schuldig, ob er nun für oder gegen eine gesetzliche Regelung sei. Der Standort der Hauptgeschäftsführung wird allerdings in einem Schreiben an das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit vom 19. 10. 1980 unter „Betreff Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Gesundheitswesens an besondere Anforderungen eines Verteidigungsfalles -Gesundheitssicherstellungsgesetz“ klar, in dem es unter anderem heißt: „Der Marburger Bund begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung, das Gesundheitswesen an die besonderen Anforderungen eines Verteidigungsfalles anzupassen und die Sicherstellung der medizinischen Versorgung für die Bevölkerung durch eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung mit eindeutiger Kompetenz und Aufgabenzuweisung zu gewährleisten.“ Die Geschlossenheit der ärztlichen Standesverbände in Sachen Medizin und Krieg ist wieder hergestellt.
Angesichts dieser Einheitsfront der ärztlichen Organe und Verbände für eine Unterstützung des militärisch-politischen Komplexes und der NATO-Strategie mit Einbindung des Gesundheitswesens in militärstrategische Überlegungen überrascht der wachsende Widerstand aus den Reihen der Ärztinnen und Ärzte selbst nicht. Die Mitgliederzahl der international ausgezeichneten IPPNW wächst und damit ihr Einfluss, nach wie vor arbeiten in vielen Krankenhäusern, Instituten und in regionalen Friedensinitiativen Ärztinnen und Ärzte mit an der Aufklärung der Bevölkerung über die Folgen eines ABC-Krieges, widersetzten sich einer Militarisierung der Medizin. Allein in München forderten im Herbst 1984 500 Ärztinnen und Ärzte auf einer Mitgliederversammlung des ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes (AKBV) die Ablehnung eines Zivilschutzgesetzes und den Verzicht auf katastrophenmedizinische Fortbildung. Der Stimmenanteil der Listen demokratischer, oppositioneller Ärzte in den Landesärztekammern wächst kontinuierlich. Die Akzeptanz der von der Standesführung geforderten Maßnahmen sinkt in der Ärzteschaft.
Auf die kommende politische Entwicklung in unserem Lande wird die Ärzteschaft einen nicht zu unterschätzenden Einfluss ausüben. Auf Grund der zutiefst persönlichen Beziehungen zu den Menschen haben Ärzte große Einwirkungsmöglichkeiten auch auf die politische Meinungsbildung. Andererseits wird die Anpassung des Gesundheitswesens an militärpolitische Erfordernisse ohne Zustimmung der Ärzteschaft nicht möglich sein.
Anmerkungen
1 Münchner Ärztlicher Anzeiger vom 22. Dez. 1984, S. 6
2 Vorläufige Stellungnahme der Bundesärztekammer zum vorläufigen Referentenentwurf eines Zivilschutzgesetzes (ZSG) vom 5. 6. 84. Rundbrief <Ärzte warnen vor dem Atomkrieg> Nr. 12 (1984) 24-26
3 Vilmar, K.: Absage an den IPPNW-Weltkongress. IPPNW-Pressestelle: 5. IPPNW-Kongress, S. 3f.
4 „Auswirkungen eines Atomkrieges“ und „Atomwaffentest-Stopp“. Deutsches Ärzteblatt 83 (1986) 1419
5 Wehrmedizinische Monatsschrift 30 (1986) 180
6 Sicherstellung. Der Arzt im Krankenhaus 35 (1982) 67
Ursprünglich erschienen in: Winfried Beck, Gine Elsner, Hans Mausbach (Hrsg.): „Pax Medica – Stationen ärztlichen Friedensengagements und Verirrungen ärztlichen Militarismus“, Hamburg 1986, S. 138-154
[1] Unter Ärzteschaft werden hier die zahlreichen Zweck- und Fachverbände mit freiwilliger Mitgliedschaft und die Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesärztekammern, alle mit Zwangsmitgliedschaft und mit alle vier Jahre neu gewählten Parlamenten, verstanden.